Zwischenruf
24.07.2024 Moderne Völkerwanderungen
Unser Bild von Gesellschaften unterstellt in der Regel eine mehr oder weniger stabile Bevölkerung, zu der sich gelegentlich auch zeitweilige Gäste einfinden können. Dieses Bild stimmt gewiss für weite Strecken in Raum und Zeit und ist Basis für alles, was mit Kulturentwicklung zu tun hat. Es wird heute – und wurde auch früher gelegentlich – von Migrations- und Flüchtlingsströmen in Frage gestellt oder Veränderungen unterworfen. Das soll jedoch nicht das Thema dieses Zwischenrufs sein. Sondern diesmal geht es um die touristischen Völkerwanderungen, eine Erscheinung, die seit maximal zwei Generationen wohl als etwas Neues in der Weltgeschichte bezeichnet werden kann.
Denken wir zum Beispiel an Venedig oder Barcelona, an Mallorca oder andere Mittelmeerküsten, also Orte, deren ganze Struktur sich unter dem Einfluss von zeitweiligen „Gästen“, die jährlich ein Vielfaches der einheimischen Bevölkerung zählen, so verändert, dass die einheimische Bevölkerung zum Außenseiter wird. Die Gäste sind zahlungskräftig, bevölkern Straßen und Plätze, prägen das öffentliche Leben und treiben die Preise für Verpflegung und Unterkunft in die Höhe. Ja, für einige der Einheimischen ist das ein gutes Geschäft, eine neue wirtschaftliche Lebensgrundlage. Aber nicht für alle. Müssen alle das so hinnehmen? Das ist eine demokratische Fragestellung!
Der Freiheit des Reisens für die einen steht die bedrohte Freiheit eigener Alltagskultur für die anderen (oder sogar für alle) entgegen. Was ist höher zu bewerten? Wer entscheidet das? Aktuell sehen wir Demonstrationen Einheimischer gegen Touristen in Mallorca oder einen lächerlichen Eintrittspreis für die Stadt Venedig als würde das jemanden vom Besuch abhalten. Versucht man die Sache mit Distanz zu betrachten, so liegen die Sympathien wohl deutlich auf der Seite der Einheimischen, deren tägliches Leben dauerhaft verändert wird, während die touristische Freiheit nur ein Tages- oder Wochen-Ereignis, aber nicht die existenziellen Lebensgrundlagen der Reisenden berührt.
Also müssten für solche Fälle Möglichkeiten bestehen oder geschaffen werden, die es den Einheimischen erlauben, in freier, gleicher und geheimer Wahl über Alternativen zur Steuerung von Touristenströmen in ihrem Lebensraum abzustimmen. Und es müssten Exekutivkräfte vorhanden sein, die das Abstimmungsergebnis auch durchsetzen. Dabei gibt es selbstverständlich Interessenkonflikte, weil es auch unter den Einheimischen zweifellos Freunde und Profiteure des Touristenstromes gibt. Wahrscheinlich würden verschieden formulierte Alternativen in verschiedenen Regionen verschiedene Ergebnisse bringen.
Aber so ist eben Demokratie, wenn sie funktioniert. Interessenunterschiede müssen artikuliert, mit Kompromissvorschlägen ausgestattet und einigermaßen ausgeglichen und dann entschieden werden. Dieses Beispiel Massentourismus kann hier nicht konkret gelöst werden (das wäre Sache der Betroffenen), sondern es wird nur angesprochen, um einmal mehr die Notwenigkeit dezentraler Strukturen als Basis demokratischen Lebens zu untermauern. Denn warum und mit welchem (anderen?!) Interesse sollte eine Stelle in Rom über das Leben in Venedig oder eine in Madrid über das in Mallorca entscheiden? Oder auch nur ein von Lobbys beeinflusster Bürgermeister oder Stadtrat? Hier geht es klassisch um den Alltag aller Menschen, die dauerhaft an einem Ort leben und die darum selbst darüber bestimmen müssen. Das erfordert eine Volksabstimmung. Wie in vielen anderen Fällen auch…
17.07.2024 Gerechter Frieden?
Das Thema der folgenden Sätze ist alles andere als neu in der Menschheitsgeschichte. Aber es stellt sich leider immer noch täglich aufs Neue: Gibt es einen ungerechten Frieden, der durch einen gerechten Krieg zu einem gerechten Frieden gemacht werden kann? Die Fragestellung mag polemisch-rhetorisch klingen und sie trägt eine negative Antwort damit bereits in sich. Aber im öffentlichen Diskurs wird die Frage bis heute auch von intelligenten und verantwortungsvollen Menschen positiv beantwortet, zumindest indirekt.
Im Ukrainekrieg haben die Befürworter der ukrainischen Kriegsführung einschließlich unserer Waffenlieferungen dorthin Argumente für sich, die auf der Völkerrechtswidrigkeit des seit Jahren anhaltenden russischen Angriffs auf ukrainisches Gebiet beruhen. Dies allein sehen zu wollen lässt jedoch die Tatsache außer Acht, dass (auch) die Ukraine die Gelegenheit, diesen Angriff zu vermeiden, ohne Not verstreichen ließ (Minsk II) und dass die Unterstützer Kiews eigene globale Machtinteressen mit diesem Ukrainekrieg verbinden. Umgekehrt kann Moskau Vertragsverletzungen, diplomatische Provokationen und (keineswegs nur einseitige) innerukrainische Gewalttätigkeiten seitens Kiew als Argumente für seine „Spezialoperation“ nennen. Allerdings rechtfertigt nichts davon einen Angriffskrieg, zumal es von Anfang an erklärtes Kriegsziel war und ist, nicht nur (vertragsgerecht) eine ostukrainische Autonomie zu ermöglichen, sondern ein kremlfreundliches Regime in Kiew zu installieren. Wer „gerechten Frieden“ als Realisierung von Demokratie und nationaler Souveränität versteht, kann sich da nur abwenden.
Auf beiden Seiten gibt es für die jeweiligen Gegenargumente maximal ein kurzes JA, dem dann ein langes und vielgestaltiges ABER folgt. Krieg als Mittel für politische Ziele benutzt immer Argumente, die nach Notwehr klingen müssen, weil kriegerische Machtpolitik keine Chance auf demokratische Zustimmung hat. Die Notwehr ist bei genauerem Hinsehen aber höchstens eine Halbwahrheit. Das gilt auch für den aktuellen Krieg in Israel und seinen besetzten Gebieten, wo ein palästinensischer Massenmord einem israelischen Völkermord gegenübersteht. Es gibt immer Gründe, jeweils einen der Kombattanten für den größeren Verbrecher oder Verursacher zu halten, was sogar zutreffen mag. Was hilft das den betroffenen unbewaffneten Menschen, von denen die meisten sich gewiss Vieles wünschen, aber keinen Krieg?
Stimmen für den Frieden sind keine, wenn sie für eine Kriegspartei Partei ergreifen. Das tun sie aber, wenn sie – nach einem kurzen allgemeinen Bedauern über das Grauen von Kriegen – ausführlich um Verständnis für die Argumente der von ihnen favorisierten Kriegspartei werben. Die ebenso mutige wie schwierige Aufgabe bestünde doch darin, zivile Friedensarbeit bis hin zu zivilem Widerstand zu entwerfen und zu praktizieren. Ja, so eine pazifistische Forderung klingt lächerlich aus dem Mund eines unbehelligten Schreibtischtäters. Trotzdem ist sie notwendig und richtig. Denn wohin führt der Weg eines „gerechten“ oder „unvermeidlichen“ Krieges? Wir sehen es täglich, gerade in Gaza, obwohl dort eine Empörung über die gewalttätige Besatzungsmacht aufgrund der jahrzehntelangen Vorgeschichte mehr als verständlich ist. Dennoch muss man fragen: war das Massaker der Hamas ein erster oder unvermeidbarer Schritt auf dem Weg zu einem gerechten Frieden? War die israelische Reaktion nicht zu erwarten oder war sie – aus religiös-ideologischen Gründen – sogar einkalkuliert? Wie weit und für wen haben die Akteure hier gedacht? Dass es sich bei den israelischen Aktionen um unverzeihliche Verbrechen handelt, muss nicht diskutiert werden. Man könnte fast meinen, dass die Angriffe sowohl am 24.02.22 als auch am 07.10.24 geradezu Geschenke an die jeweiligen Gegner waren, denen dies gut in ihre Pläne passte.
Auch wenn der Ruf nach zivilem Widerstand gegen Ungerechtigkeiten in vielen Fällen zynisch klingen mag: es muss bessere Taten als die genannten Angriffe geben, das zeigen doch die Ergebnisse! Sie zu erarbeiten ist eine Menschheitsaufgabe, im Großen und im Kleinen. Es gibt gerade in solchen Situationen Menschen, die uns dafür immer wieder ein Beispiel geben. Deshalb widme ich diesen Beitrag Frau Sumaya Farhat-Naser.
23.06.2024 EU – Demokratie?
Nach der Wahl zum EU-Parlament wird das Wahlergebnis gern als Gefahr für die Demokratie kommentiert, weil die rechte Seite des politischen Spektrums stärker wurde. Zu viele BürgerInnen seien den PopulistInnen auf den Leim gegangen. Das ist eine ziemlich oberflächliche Betrachtung. Zu diesen „Rechtsradikalen“ zählen immerhin eine demokratisch gewählte Regierungschefin in Italien und eine seit längerem etablierte Oppositionsführerin in Frankreich, die sich beide nicht nur von ihrer Vergangenheit schrittweise distanzieren, sondern inzwischen sogar von der deutschen Rechts-Partei. In Skandinavien ist das Rechts-links-Ergebnis umgekehrt ausgefallen und in Ungarn verzeichnet die Opposition zur rechts eingestuften Regierung ebenfalls Gewinne. Zweifellos hat in Deutschland und in Frankreich eine Rechtsverschiebung zulasten der Mitte stattgefunden, obwohl insgesamt die proeuropäische Mitte eine Mehrheit geblieben ist. Soweit das Ergebnis in groben Zügen. Es lohnt sich aber, etwas grundsätzlicher hinzuschauen.
Ein demokratisches Parlament?
Zuerst sollten wir uns einmal fragen, was es mit der euro-skeptischen Haltung von (angeblich?) zweifelhaften Demokraten auf sich hat, oder genauer: wie die EU-Parlamentswahl selbst unter demokratischen Gesichtspunkten zu werten ist. Denn dieses Parlament ist eine „Legislative“ ohne eigene Kompetenz für Gesetzesinitiativen. Es vertritt ein „Wahlvolk“, welches nicht existiert – eine europäische Bürgerschaft hat sich niemals konstituiert – und wenn es sie als Souverän geben würde, wäre sie im Parlament durch eine Ungleichheit „repräsentiert“, gegenüber der das wilhelminische Klassenwahlrecht geradezu demokratisch genannt werden müsste. Denn die Stimmengewichte der WählerInnen sind in einzelnen Ländern krass unterschiedlich und auch die Wahlsysteme sind sehr verschieden. Von einer Gleichheit der Wahl – eine demokratische Selbstverständlichkeit! – kann keine Rede sein.
In einer Demokratie gilt „one man one vote“, wobei jede Stimme ungefähr dasselbe Gewicht haben muss. Um die Kleinstaaten besser zu schützen, könnte man eine zweite Kammer einrichten, in der jede Nation gleiches Stimmrecht hat, analog dem Föderalismus in den USA oder in der Schweiz. Ob oder wofür in dieser Kammer Einstimmigkeit erforderlich wäre, müsste vorab einstimmig (!) entschieden werden. Dies hier nur als Randbemerkung. Selbstverständlich müsste ein europäisches Parlament nicht nur – einerseits – Kompetenz zur Gesetzesinitiative haben, sondern diese dürfte – andererseits – nicht unbegrenzt sein. Sie dürfte im Sinne der Subsidiarität nur supranationale Gegenstände erfassen.
Dies alles ist beim EU-Parlament nicht gegeben. Das wissen viele EU-kritische WählerInnen. Diesen Hintergrund müssen wir uns bei der Bewertung des Wahlergebnisses bewusst machen. Denn die Wahl „eurokritischer“ Parteien ist auch eine Kritik an diesen demokratiefernen Strukturen. Dass es sich bei diesem Parlament zulasten der Steuerzahler darüber hinaus um eine extrem teure Veranstaltung handelt mit hochbezahltem Personal und jährlich zweifachem Umzugszirkus zwischen Straßburg und Brüssel, trägt ebenfalls nicht zur Beliebtheit dieser Institution und ihrer Befürworter bei.
Undemokratische Populisten?
Zweifellos sind die Parteien des rechten Spektrums, nicht nur in Deutschland, auch von Menschen gewählt worden, deren rassistischen Einstellungen man keinerlei politischen Einfluss wünscht. In diesen Parteien haben sich manch Ewiggestrige versammelt, die mit überproportional lauter Stimme und manchmal auch aggressiven Aktionen das Erscheinungsbild und auch manche Programmaussagen prägen.
Die Mehrheit dieser WählerInnen und auch die politische Programmatik der rechten Parteien ist damit aber nicht erschöpfend beschrieben. Denn das Motiv nationalbewusster WählerInnen hat einen demokratischen Kern, was im vorigen Abschnitt angedeutet wurde. Außerdem registrieren sie nicht zu Unrecht, dass die Parteien der alten Mitte sich immer weiter von den Interessen der BürgerInnen entfernen, dass sie zunehmend zu „erzieherischen“ Maßnahmen auch gegen Mehrheitsmeinungen greifen, dass sie einen europäischen Zentralismus zulasten nationaler Souveränität propagieren … Man kann weitere Themen aufzählen, bei denen man als „Oppositioneller“ nicht automatisch Antidemokrat ist: Die seit Jahren gewachsenen Migrations- und Integrationsprobleme vor allem in Frankreich, aber auch in Deutschland; die nicht nur aufdringlich-belehrende, sondern auch unrealistisch konzipierte Klimapolitik vor allem in Deutschland; die Vielzahl von Detailregelungen, die keineswegs supranational festgelegt, aber trotzdem nationales Recht werden müssen… Wen kann man heute in Deutschland (und anderswo) wählen, wenn man die „demokratischen Defizite“ der EU und problematische Entscheidungen etablierter Entscheidungsträger erkannt hat, aber nicht akzeptieren will? Wen kann man wählen, wenn man, ohne NationalistIn zu sein, auf nationale Souveränität als demokratische Selbstverständlichkeit nicht verzichten will? Eben. Dagegen helfen in einer Demokratie keine „Brandmauern“.
Es stimmt, viele WählerInnen rechter Parteien mögen sich gegenüber undemokratischen Inhalten dieser Parteien gleichgültig verhalten, auch wenn sie sie nicht teilen, nicht wenige begrüßen sie sogar. Und manche von ihnen projizieren unangemessene Wünsche in ihre Hoffnungs-Partei, zum Beispiel wenn sie friedliche Ambitionen haben. Denn auch wenn z.B. die AfD aktuell gegen Waffenlieferungen in Kriegsgebiete stimmt, darf man sie nicht als Friedenspartei missverstehen.
Informationsstelle Militarisierung (IMI) » Warum die AfD keine Friedenspartei ist (imi-online.de)
Es ist ein großer Block von demokratisch-oppositionellem Gedankengut im Lauf der Jahre angewachsen, teilweise mit guten Gründen, die bei den staatstragenden Parteien zu wenig Verständnis und Vertretung findet.
Zu den Ergebnissen dieser Wahl gehört aber auch, dass eine sympathischere Alternative zur „Alternative“ aus dem Stand 6 % der Stimmen gewonnen hat, quer durch die Generationen. Hier wird eine klassisch-sozialdemokratische Kritik an der „politischen Mitte“ geübt, die trotz teilweise ähnlicher Kritik am „Mainstream“ erstaunlicherweise von den Medien geradezu gepusht wird. Offenbar ist die Meinungsfreiheit hierzulande doch nicht so kaputt wie manche Kritiker das gerne hätten. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass ausgerechnet Frau Wagenknecht in ihren Plakaten auf eine gefährdete Meinungsfreiheit hinweist, obwohl sie und ihre Partei seit langem in den großen Medien eher überproportional vertreten sind und dort keineswegs nur als Sündenbock auftreten dürfen.
Undemokratische Zentralisten?
Sorgen bereitet einem Demokraten allerdings die Tatsache, dass auch bei den JungwählerInnen nicht nur die AfD gut abschneidet, sondern dass hier „umgekehrt“ eine Partei „Volt“ 9 % der Stimmen gewonnen hat, eine Partei, die noch konsequenter als Grüne, SPD und CDU zusammen die nationalen Souveränitäten auflösen und einen EU-Bundesstaat schaffen will, um noch machtvoller und effektiver eine Ökodiktatur umsetzen zu können. Sie machen selbst daraus fast keinen Hehl:
Plötzlich bei fast 3 Prozent: Wer hinter der Kleinpartei Volt steckt | GMX
Den Volt-WählerInnen fehlt es nicht etwa an mehr Demokratie auf europäischer Ebene, sondern an zentral durchregierender grün-europäischer Macht – vorausgesetzt, sie haben überhaupt die politischen Ziele dieser Partei verstanden und nicht einfach die absurde Wahlwerbung „Sei kein Arschloch“ cool gefunden. In beiden Fällen würde sich allerdings ein erschreckender Verlust an historischer und staatsbürgerlicher Bildung zeigen – nicht zuletzt ein Ergebnis jahrzehntelanger Schulreformen…
Es ist aber wahrscheinlich so, dass von dieser Partei nur deutlicher als von anderen ausgesprochen wird, welches der eigentliche Fahrplan des Projektes Europäische Union ist. Denn dass Zentralisierungstendenzen seit Jahrzehnten der Motor aller EU-Aktivitäten sind, kann kaum übersehen werden. Insofern sammeln sich hier wohl die WählerInnen, bei denen eine antinationale EU-Propaganda inzwischen die süßesten Früchte trägt.
Demokratie in Europa
Aus all diesen Beobachtungen folgt eine wichtige Aufgabe: Wir sollten uns weniger Gedanken darüber machen, wen wir ins EU-Parlament wählen oder nicht wählen wollen. Sondern vor allem darüber, wie Demokratie in Europa zu organisieren wäre. Der eingeschlagene Weg weg von nationaler Souveränität und hin zu einem merkwürdigen supranationalen Konstrukt mit einer Kommission als legislativen Machzentrum wird von vielen Bürgern ganz offensichtlich nicht goutiert. Unter demokratischen Gesichtspunkten ist dieses Konstrukt, das aus ganz anderen Zusammenhängen heraus entwickelt, bzw. umfunktioniert wurde (Montan-Union), in der Tat mehr als fragwürdig.
Wenn wir diese Geschichte noch einmal auf „reset“ drücken könnten, müssten wir zunächst darüber nachdenken, was Demokratie ist, welche wesentlichen Elemente dazugehören und wie diese dann auf europäischer Ebene zu realisieren wären. Bei dem seit Jahrzehnten stattfindenden Aufbau einer Europäischen Union standen solche Überlegungen kaum Pate.
Grundvoraussetzung für alle, die auf diesem Feld mitreden oder gar handeln wollen, ist natürlich eine intensive historische und staatsbürgerliche Bildung. Mit aller Vorsicht darf man feststellen, dass hier nicht nur bei den JungwählerInnen Luft nach oben ist, sodass langfristig angelegte, intensive und breite Bildung auf die Tagesordnung gehört. Nicht so sehr, damit die Bürger „richtig“ wählen, sondern vor allem, um die anspruchsvollere Aufgabe in den Blick zu nehmen: richtige Organisationsformen für eine Europäische Demokratie zu finden und weiterzuentwickeln. Das muss jedem/jeder Wähler/in und vor allem jedem/jeder Gewählten ein Anliegen sein.
Richtig im Sinne von Demokratie ist es, dass die Entscheidungsebenen subsidiär organisiert sind. Das beinhaltet funktionierenden Föderalismus inkl. Erhalt nationaler Souveränität. Deshalb darf eine supranationale Legislative nicht in national, regional oder lokal zu regelnde Themen eingreifen. Eine weitere Selbstverständlichkeit ist die Gewaltenteilung, die ebenfalls für eine supranationale Struktur gelten muss, sodass eine europäische Rechtsprechung nicht in nationale eingreifen darf, was gelegentlich schon geschehen ist. Und natürlich: Gleichheit bei Wahlen für jede Bürgerstimme, was ein supranational gleiches Wahlrecht voraussetzt und eine zweite Kammer mit Gleichheit für die Nationen nahelegt. Also: Souveränität, Subsidiarität, Gewaltenteilung, Gleichheit sind Voraussetzungen demokratischer Freiheit. All das ist in der heutigen EU schlecht oder gar nicht realisiert. Vorab wäre dafür eine ebenfalls nicht existierende Verfassung zu konzipieren und zu beschließen, mit der sich eine europäische Bürgerschaft erst einmal selbst konstituieren müsste. Wenn sie – die Bürger, nicht die Regierungen – das denn wollen…
Ausblick
Natürlich gibt es im historischen Prozess keinen Reset-Knopf. Aber es gibt eine Freiheit des Denkens, die es erlaubt, sich immer wieder an die Grundlagen zu erinnern und das Bestehende daran zu messen, um Änderungen in eine richtige Richtung zu lenken. Nichts ist in Stein gemeißelt. Wenn wir BürgerInnen in Europa ernsthaft überlegen, wie wir eine internationale Kooperation demokratisch organisieren können, käme gewiss etwas anderes heraus als ein teures und ziemlich ohnmächtiges EU-Parlament mit nationalistisch überhitzten Fraktionen – was eben (auch) eine Folge von real existierender Mangelhaftigkeit seiner demokratischen Strukturen ist.
Warum kann es nicht weiterhin verschiedene europäische Demokratien mit all ihren historischen Besonderheiten und nationalen Souveränitäten geben – und zugleich eine übergeordnete Struktur für ausschließlich als übergeordnet definierte Gegenstände? Die Schweiz und die USA könnten gedankliche Anregung für supranationale Strukturen sein – natürlich nicht als 1:1 zu kopierendes Modell. Immerhin scheinen die einzelnen US-Staaten in mancher Hinsicht sogar mehr Selbständigkeit zu besitzen als heute schon die EU-Staaten, deren Gesetzgebung durchweg „EU-kompatibel“ sein muss. Anders als die US-Staaten sollten die EU-Staaten aufgrund ihrer langen eigenständigen Geschichten allerdings auch weiterhin ihre Außenpolitik souverän bestimmen können. Eine EU-Supra-Nation sollte nur für EU-interne supranationale Themen Kompetenz erhalten.
Fazit: Wenn unsere PolitikerInnen solche demokratie-orientierten Überlegungen, die hier nur kurz und längst nicht zu Ende gedacht gestreift wurden, öffentlich anstellen und vielleicht sogar Taten folgen lassen würden, wäre NationalistInnen oder anderen ExtremistInnen viel Wind aus den Segeln genommen. Das wäre gewiss die beste Brandmauer gegen alle Feinde der Demokratie. Denn Demokratie lebt nicht so sehr von machtvollen Meinungsdemonstration gegen rechts oder links oder sonstige Andersdenkende; sondern von der inhaltlichen Auseinandersetzung mit diesen Andersdenkenden mit dem Ziel der demokratischen Weiterentwicklung des öffentlichen Lebens.
09.06.2024 Die Würde auch des sterbenden Menschen ist unantastbar
Zur Zeit wird wieder einmal die „Widerspruchslösung“ im Zusammenhang mit dem Thema Organspende von Politikern öffentlich diskutiert, bzw. gefordert. Das heißt, es wird diskutiert, ob jeder Mensch als Organspender gelten soll, wenn er nicht ausdrücklich widersprochen hat. Da lohnt es sich doch, auch in diesem Zusammenhang noch einmal an den ersten Satz des Grundgesetzes zu erinnern, der ebenfalls in diesen Tagen (75jähriges Jubiläum!) gern von den Politikern in den Mund genommen wird (siehe Überschrift).
Es fehlt in dieser Diskussion an Aufklärung darüber, was die Feststellung des Hirntodes als Voraussetzung für eine Organentnahme bedeutet. Vielen Menschen ist vielleicht nicht klar, dass Organe nicht einer Leiche entnommen werden können, die „mausetot“ ist. Sondern sie können nur Jemandem entnommen und einer anderen Person transplantiert werden, wenn die Organe selbst noch in Funktion sind, also am Leben erhalten werden. Die hirntote Person muss künstlich beatmet und der Blutkreislauf muss aufrechterhalten werden. Das geht nur, wenn die Person auf einer Intensivstation verstirbt, bzw. wenn dort der Hirntod festgestellt wird, von dem es nach medizinischer Expertise kein Zurück mehr ins Leben gibt.
Folglich weiß auch niemand, wie dieses Sterben sich anfühlt, bzw. ob die pulsierenden Organe bei ihrer Entnahme etwas spüren. Natürlich kann man davon ausgehen, dass hier keine Empfindung mehr stattfindet, aber wer weiß das? Es muss selbstverständlich bleiben, dass auch dieser letzte Akt beim Erlöschen des Lebens dem Gebot der körperlichen Unversehrtheit unterliegt. Niemand außer der Person selbst, auch nicht nahe Verwandte, dürfen das in Frage stellen. Umgekehrt steht es jedem frei, sich zum Spender zu erklären und zu bestimmen, dass er im Fall einer endgültigen Erkrankung oder eines (nahezu?) tödlichen Unfalls auf einer Intensivstation sterben will und im Stadium zwischen Hirntod und körperlichem Tod Organe entnehmen zu lassen erlaubt.
Aber es muss klar bleiben, dass dies eine Spende ist. Eine Spende, die nur die spendende Person selbst geben kann, wenn sie es ausdrücklich und im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte so entscheidet. Jedem Menschen, dessen Leben von einer Organspende abhängt, ist zu wünschen, dass ein Spender für ihn gefunden wird. Aber niemand hat ein Recht auf das Organ eines anderen, eines sterbenden Menschen. Ebenso wenig hat irgendeine politische Macht, sei es ein despotischer Autokrat, sei es ein demokratisches Parlament, das Recht, ihre sterbenden Bürger generell zum Organersatzteillager zu erklären – denn von einer Spende könnte unter dieser Bedingung keine Rede mehr sein.
02.06.2024 Direkte Demokratie und Globalisierung
Das Plädoyer dieser Website für direkte, also möglichst dezentrale Demokratie wirft in einer global vernetzten und technisch digitalisierten Welt Fragen auf. Kommt die Vorstellung von Gemeindeautonomie, föderaler Staatsstruktur, nationaler Souveränität nicht aus einer Zeit historischer Sondersituationen in Europa, als es im frühen Mittelalter autonome Talschaften in der Schweiz, im späten Mittelalter relativ freie Städte im deutschen Reich und in Italien, in der frühen Neuzeit dann nationale Grenzen als Folge blutiger Kriege gegeben hat? Sind in anderen Teilen der Welt dieselben oder auch nur ähnliche Strukturen entstanden? Ist (direkte) Demokratie also vielleicht kein verallgemeinerbares oder gar zeitloses Modell für eine gerechte politische Welt?
Ja, politische Vorstellungen von Demokratie wurden in Europa entwickelt. In Asien, Afrika, Amerika etc. hat es zwar auch genossenschaftliche Strukturen gegeben, aber weniger Entwicklungen in Richtung politischer Demokratie. Die heutigen mehr oder weniger demokratischen Nationen, vor allem in Afrika und in Amerika, sind mehr noch als in Europa ein Ergebnis äußerlich aufgezwungener oder willkürlich gezogener Grenzen, ein durch Eroberungskriege geprägter Flickenteppich willkürlicher Entscheidungen, einschließlich der Etablierung europäischer, also nicht einheimischer Sprachen. In Asien zeigen die heutigen Staaten zwar in größerem Maß das Abbild einheimischer Kulturen, allerdings ebenfalls geprägt von teils eigener, teils fremder Eroberungswillkür und oft weniger (direkt)demokratisch gewachsen als in vielen Teilen unseres Kontinents.
Diese Tatsachen können ein „eurozentristisches“ Demokratie-Modell also vehement in Frage stellen. Hinzu kommt die Tatsache, dass auch in der europäischen Geschichte dezentrale politische Strukturen zwar Wunschvorstellungen, tatsächlich aber meist unvollkommene Realisierungen sind. Die freien Städte des Mittelalters waren ihrerseits Zentren von umliegenden Ländereien und kleineren Gemeinden, die selbst unfrei waren; die Städte waren intern kaum demokratisch organisiert, selbst dann nicht, wenn es sich um „freie“ Städte und nicht um Herrschaftssitze handelte. Fernand Braudel (Bibliothek) gibt ein sehr anschauliches Bild von der Realität der politischen Strukturen in Europa und anderswo seit dem späten Mittelalter.
Aber auch und gerade in der unvollkommenen Realität konnte über die Jahrhunderte der Wunsch nach besseren Modellen der entstandenen demokratischen Ideen wachsen. Bessere Vorstellungen davon, wie die Menschen die öffentlichen Angelegenheiten in ihrem Wirkungsbereich genossenschaftlich regeln anstatt von externen Mächtigen reglementiert zu werden. Oder davon, dass es überhaupt möglich ist, gesellschaftliches Leben mit persönlicher Freiheit und Verantwortung eines jeden zu verbinden, sodass gerechtere Zustände für alle entstehen können. Wie gut oder schlecht das in verschiedenen historischen Situationen gelungen sein mag: die Idee war vorhanden, sie gab und gibt Orientierung. Nicht zufällig orientieren sich politische Bewegungen in anderen Teilen der Welt bis heute an europäischen Vorstellungen, wenn sie eigene politische Realitäten verbessern wollen. Solche Oppositionsbewegungen sind nicht nur Ergebnis machtpolitisch verbreiteter Propaganda, das sicher auch, sondern basieren darauf, dass demokratische Freiheit mit europäischen politischen Ideen und Realitäten assoziiert wird, selbst wenn manches dabei idealisiert wahrgenommen wird.
Das Thema (direkte) Demokratie betrifft aber nicht nur die Frage nach der Vollkommenheit realer Strukturen, als wäre dies ahistorisch ein für allemal zu beantworten, sondern erfordert auch Antworten, welche öffentlichen Themen heute und morgen auf welchen Ebenen überhaupt anzusiedeln sind. Damit ist unsere gegenwärtige und zukünftige Welt angesprochen, in der weltweite Produktionsverlagerungen und Handelsströme, die Mobilität der Menschen und ihre globale Kommunikation ein noch vor 70 Jahren unvorstellbares Ausmaß angenommen haben. Was kann eine Gemeinde da noch für sich selbst autonom bestimmen? Oder selbst eine Nation? So fragen manche modernen Menschen, und stellen Föderalismus und „Nationalismus“ als überlebt, wenn nicht gar gefährlich in Frage. Hat nicht die Corona-Pandemie gezeigt, dass wir in Deutschland kaum noch Medikamente selbst herstellen, sondern diese aus Indien und China beziehen? Die Versorgung unserer kranken und alten Menschen würde nicht funktionieren ohne Arbeitskräfte aus Polen oder Indonesien. Unsere Automobil- und Maschinenbauindustrie läge am Boden ohne den Export ihrer Produkte in alle Welt. Von Energie-Abhängigkeiten ganz zu schweigen. Und so weiter.
Wo bleibt da also Raum für dezentrale Entscheidungen? Wozu überhaupt noch Grenzen? fragen diejenigen, die sich allerdings zu wenige Gedanken darüber machen, wie das gesellschaftliche und kulturelle Leben des sozialen Wesens Mensch funktioniert. Denn auch wenn wir uns gedanklich als Weltbürger verstehen und heute über globale Netze sekundenschnell miteinander kommunizieren können, bleiben wir kulturell geprägte Individuen, die einen konkreten materiellen, „analogen“ Lebensbereich haben, den wir gestalten wollen. Dafür wollen wir die heutigen und zukünftigen Möglichkeiten natürlich nutzen – aber nicht so, dass wir uns ihnen unterordnen als sei die Technik das Subjekt der Geschichte und wir das Objekt. Es ist anspruchsvoll, dies umgekehrt zu praktizieren. Wir müssen heute Entscheidungen treffen, von denen ein mittelalterlicher Stadtrat keine Vorstellung hatte. Aber warum können wir nicht beschließen, dass ein Mindestmaß an pharmazeutischer Produktion im eigenen Land zu geschehen hat? Warum bieten wir Pflegekräften keine anständig bezahlte Arbeit, sodass mehr von uns diesen Beruf ausüben wollen und die Indonesierinnen ihre eigenen Kranken pflegen können? Warum sollte eine Gemeinde nicht selbst beschließen können, ob sie sich ein Krankenhaus, eine Schule leisten will – vorausgesetzt, sie verfügt über finanzielle Gemeindeautonomie? Womit wir wieder bei der direkten dezentralen Demokratie sind.
Die verbreitete Vorstellung, dass eine tatsächlich stattfindende technisch-wirtschaftliche Globalisierung auch zu politischem Zentralismus führen muss, ist ein Irrtum. Natürlich verändern sich die Aufgabenstellungen, sie werden sachlich oft anspruchsvoller und es muss geklärt werden, was auf welcher Ebene zu entscheiden ist. Die Antworten dazu können in verschiedenen Staaten, Nationen, Kulturen je nach ihrer Geschichte verschieden ausfallen. Auch die Entscheidungsebenen müssen und können nicht überall dieselben sein. Städtische Agglomerationen von 20 Mio. Einwohnern müssen sich wohl anders strukturieren als eine Region mit Gemeinden von plus/minus 100.000 Einwohnern. Aber überall gilt, dass gewiss nicht alles in einer fernen Zentrale entschieden werden muss. Oder auch nur kann. Wir sehen ja, dass die Entscheidungen unserer Abgeordneten und Regierenden in zunehmendem Maß von fehlendem Sachverstand geprägt sind. Deren Entscheidungen fallen zu weit weg von den Bürgern und zu nah an den Lobbygruppen – Lobbygruppen, die den politischen Entscheidungsbefugten so nah auf der Pelle sitzen, dass diese weder „ihre“ Bürger noch die komplexer werdenden Sachen selbst angemessen erkennen können. Von ideologischen Vorurteilen vieler politischer Entscheidungsbefugter mal ganz abgesehen. Wenn wir uns auf die in unserer Geschichte entstandene Idee bürgerlicher Freiheit und genossenschaftlicher Organisation des öffentlichen Lebens besinnen, werden wir gewiss fündig bei der Suche nach direkt von uns Bürgern zu treffenden Entscheidungen – Entscheidungen, die sowohl lokale als auch globale Wirkung haben können. Denken wir zum Beispiel an die aktuelle Frage, ob oder wie man sich an Kriegen in anderen Ländern beteiligt. Warum soll zu dieser wahrhaft existenziellen Frage nicht jeder Bürger direkt entscheidungsbefugt sein? Wir müssen die Aufgabe demokratischer Verantwortung nur richtig verstehen. Und anpacken.
22.05.2024 Private oder öffentliche Diktaturen? oder was?
Wir haben eine Vorstellung und eine Realität von Demokratie, in der wir Bürger andere Mitbürger oder Parteien wählen, die für einen gewissen Zeitraum die öffentlichen Angelegenheiten im Interesse der Bürger regeln sollen. Wir verstehen, dass es bei Interessengegensätzen notwendige Kompromisse geben muss. Wir erwarten, dass die Institutionen die Einhaltung der Regeln sicherstellen. Wir freuen uns, wenn es Regelungen gibt, mit denen die Bürgerschaft selbst direkt sachliche Entscheidungen treffen, also Gesetze bestimmen kann. Wir wissen, dass das nicht immer und überall perfekt funktioniert, aber wir haben Vertrauen in ein grundsätzliches Modell von parlamentarischer und möglichst auch direkter Demokratie. Das ist eine Errungenschaft und ein Vermächtnis unserer europäischen Geschichte.
Aufmerksame Zeitgenossen nehmen zur Kenntnis, dass die Entscheidungen der gewählten Politiker in zunehmendem Maß von privaten Lobbygruppen bis hin zu mächtigen Vermögensverwaltern (Stichwort: Black Rock u.a.) beeinflusst werden und dass der Anschein demokratischer Legitimation oft nur noch mit ausgefeilter Propaganda halbwegs aufrecht erhalten werden kann. In welchem Maß diese Einschätzung stimmt oder Übertreibungen enthält, ist hier nicht Thema. (Vertiefungen hierzu siehe Bibliothek, z.B. bei den Autoren Rügemer oder Ploppa o.a.). Thema ist hier, dass manch einer aus solchen Beobachtungen den Schluss zieht, unsere Demokratie sei kaum noch der Rede wert. Im Zusammenhang mit altehrwürdigen Elitetheorien marxistischer Prägung (was z.B. unter Demokratie als Erziehungsdiktatur? genauer betrachtet wird) und mit der Einschätzung, dass die westliche Welt mit der Führungsmacht USA sowieso und Gott sei Dank auf das historische Abstellgleis fährt, orientiert man sich dann gerne neu.
Aber wohin orientiert man sich? „Mainstreamkritische“ Medien, die es in nicht geringer Zahl und mit nicht geringer Reichweite hierzulande gibt, zeigen trotz mancher Unterschiedlichkeiten eine Gemeinsamkeit: ein positives Interesse an der aufstrebenden Weltmacht China, Bewunderung für deren Erfolge bei der Bekämpfung von Armut und Hunger im eigenen Land, Applaus für friedliche Entwicklungen im Rahmen des „Seidenstraßen“-Projektes etc.; ebenso zählt viel Verständnis für das (angeblich) vom Westen angegriffene, aber von China gottlob unterstützte Russland dazu und generell eine große Sympathie für die BRICS-Staaten und ihre neuen Mitglieder im mittleren Osten und anderswo. So sehr man Respekt vor den Unabhängigkeitsbestrebungen gegenüber den USA und vor der wirtschaftlichen Entwicklung Chinas haben muss – ist das ein Grund, die Achseln darüber zu zucken, dass es in China intern diktatorisch zugeht und extern wirtschaftliche Abhängigkeiten und Schuldverhältnisse geschaffen werden? Ist es ein Grund, sich über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine nicht zu empören oder über die religiöse Diktatur in Iran und die Korruption in Südafrika? Derartige Tatsachen werden bei dieser Neuorientierung gern „übersehen“.
Mit diesen Fragen und Hinweisen sollen weder die Verbrechen der westlichen Weltpolitik noch die Erfolge der nicht westlich orientierten Staaten geleugnet werden. Sondern es wird eine intellektuelle Redlichkeit eingefordert, um selektive Wahrnehmungen zu vermeiden. Wenn unser früher vielleicht einmal blindes Vertrauen ins eigene System enttäuscht wurde, sind wir schlecht beraten, anderen Systemen blind zu vertrauen, schon gar nicht, wenn deren (andere) erhebliche Mängel ins Auge springen. Warum orientieren wir uns nicht an dem, was unsere Geschichte und Kultur uns nahelegt? Wenn unsere Demokratie schlecht funktioniert, müssen wir sie besser (be)leben – aber nicht mehr oder weniger undemokratische aufstrebende Weltmächte kritikfrei stellen. Natürlich sollten wir mit dem russischen Nachbarn ein gemeinsames Haus bauen – aber nicht, solange er sich entschlossen hat, jahrelang massiv Krieg gegen seinen Nachbarn zu führen und ihm die Souveränität abzusprechen. Natürlich dürfen wir selbst uns nicht auch nur indirekt an Kriegen in anderen Ländern, z.B. dem Super-Korruptionsstaat Ukraine, beteiligen, bei denen es „nur“ um geopolitische Strategien, aber nicht etwa um Demokratie geht.
Unsere europäische Kulturgeschichte muss in ihrer Vielfältigkeit, in ihren wechselseitigen Beziehungen durch die aktive Belebung und Verbesserung ihrer Demokratien unsere Basis für die Zukunft sein. Das ist etwas anderes als die derzeit „moderne“ Privatisierung alles Öffentlichen und seine Unterwerfung unter maßlose Profitmaximierung; es ist etwas anderes als die zentralistischen Etatismen des „globalen Südens“, die sich aus politischen, nationalistischen oder religiösen Machtansprüchen verschiedener Eliten speisen. Vielmehr müssen wir uns die demokratischen Traditionen unserer europäischen Geschichte wieder bewusst machen, pflegen, weiterentwickeln – souverän und friedlich, aber ausreichend lautstark gegen falsche Einflüsse und „Vorbilder“ aus West und Ost und Süd, siehe auch Zwischenruf 05.06.2023.
Wenn wir die geostrategischen Fixierungen in den Hintergrund schieben, können wir uns besser auf das Wesentliche konzentrieren: Demokratie und Frieden.
03.05.2024 Regelbasierte Ordnung
Es war einmal, da galt der Spruch „L´etat, c´est moi“ des Königs Louis XIV als Ausdruck absoluter Monarchie, als Gipfel der Selbstherrlichkeit. Zu Recht. Heute sollte ein Spruch „La democratie, ces sont nous, les citoyens“ gültig sein, aber zumindest im Fall internationaler Politik sind das „Wir“ nicht die Bürger der demokratischen Staaten, sondern die Eliten der westlichen Demokratien, die sich allmählich dem Geist annähern, den Louis XIV vorgelebt hat. Nur die Propaganda muss ein wenig angepasst werden, wenn man nicht Gott, sondern den Wählern Rechenschaft schuldet.
Ein Beispiel für das Voranschreiten der Willkür: Statt vom Völkerrecht, zu dem fast alle Nationen sich verpflichtet haben, ist seit Jahren von einer „regelbasierten Ordnung“ https://de.wikipedia.org/wiki/Regelbasierte_Ordnung die Rede, die international durchzusetzen sei. Darunter verstehen ihre Verfechter einen undefinierten und verschieden interpretierbaren Kanon „westlicher Werte“ und reklamieren damit eine Selbstherrlichkeit gegenüber den Staaten, deren „Werte“ der Westen nicht zu seiner Ordnungsregel zählt. Es geht hier nicht um „graue Theorie,“ sondern (um in Goethes Farbenwahl zu bleiben) um grüne Praxis: denn man leitet aus solch verschwurbelter Unbegrifflichkeit auch Kriegsbeteiligungen und Waffenbrüderschaften gegen die unterstellte Werte-Unordnung von Anderen ab. Nicht einmal die empörte Ignoranz Israels gegenüber den Vorgaben des Internationalen Gerichtshofes, wie ein Völkermord in Gaza vermieden werden muss, hindert die regelbasierten Ordnungshüter daran, weiterhin Waffen an den Ignoranten zu liefern.
Verschiedene Kriege, die „wir“ in den letzten Jahrzehnten für unsere Interessen geführt haben, waren ausdrücklich völkerrechtswidrig, was auch ein Bundeskanzler Schröder im Fall Jugoslawien unumwunden und geradezu selbstbewusst zugab – wir mussten das doch ganz selbstlos auf uns nehmen! Andere völkerrechtswidrige Kriege, die zum Beispiel von Russland gegen unsere Interessen geführt werden, bekämpfen wir dagegen nicht nur mit Worten, sondern mit Waffen. Unsere regelbasierte Ordnung zwingt uns eben manchmal, gegen Völkerrechtsbrüche vorzugehen, aber manchmal auch, sie selber zu begehen. Wir sind die Demokraten, also bestimmen wir, was zu tun ist, ob das nun gefällt oder nicht. „Quod licet Jovi non licet bovi“ pflegte mein Vater zu sagen (was Gott erlaubt ist, ist dem Rindvieh nicht erlaubt.) Fazit: Es kommt nicht darauf an, was man tut, sondern wer es tut, siehe hierzu das Kapitel „Nationalismus“ unter dem Button „Genauer betrachtet“. Grundsätze eines Westfälischen Friedens sind lange vergessen.
Es ist nur logisch, dass wir unsere situationsangepassten Ordnungsregeln, die wir im Zweifel über das Völkerrecht stellen, lieber nicht so genau definieren, denn wenn wir damit anfangen würden, müssten wir erstens feststellen, dass unsere westlichen Demokratien selbst sich so deutlich voneinander unterscheiden (siehe „Nationale Vielfalt“ unter dem Button „Kernthemen“), dass es sogar schwierig wird, eine regelbasierte Definition von Demokratie zu geben, mit der man Freund und Feind ein für allemal unterscheiden könnte. Zweitens könnten wir dann auch nicht mehr so flexibel internationale Politik betreiben, wie wir das „regelbasiert“ tatsächlich tun: Haben die Vertreter westlicher Werte nicht z.B. jahrelang den irakischen Herrscher militärisch gegen die iranischen Mullahs in den Krieg getrieben und hunderttausende Tote auf beiden Seiten ausdrücklich in Kauf genommen, um ihn später zum übelsten Diktator zu erklären, der über Waffenvernichtungsmittel verfüge (womit nur die inzwischen schrottreifen, vom Westen vorher gelieferten gemeint sein konnten)? Nennen wir mit Israel nicht einen Staat demokratisch, der unmissverständlich und unverrückbar zweierlei sehr verschiedenes Recht für Juden und Nichtjuden in seinem Geltungsbereich praktiziert und selbst daran gemessen noch Unrecht tut? Das sind nur Beispiele, deren Liste sich verlängern lässt. Seien wir also lieber vorsichtig mit theoretischen Definitionen. Wer weiß schon, wen wir morgen „regelbasiert“ zum Feind oder Freund umbenennen müssen.
Es gibt auch kleinere Beispiel unterhalb der Kriegsführung. Nur ein beliebiges aktuelles: Augenblicklich wird Georgien wegen „undemokratischer“ Praktiken kritisiert, weil es ausländische NGOs besser kontrollieren oder ggf. sogar verbieten wolle und sich damit dem indiskutabel undemokratischen Vorgehen Russlands anschließe. Dabei haben unsere Nachrichten nicht einmal ein Problem damit, auf die selbstverständlich von uns unterstützten vielen „Nicht“-Regierungsorganisationen in Georgien hinzuweisen, die sich dort für Demokratie einsetzten – womit sie unsere Einmischung in deren inneren Angelegenheiten bestätigen. Der Ruf nach Demokratie in Georgien wird von denen ausgestoßen, die ihrerseits digitale russische Medien hierzulande nicht kontrolliert, sondern verboten haben. Und die keinen Hehl daraus machen, in eine ukrainische Oppositionsbewegung 5 Mrd. US-Dollar investiert zu haben. Das war regelbasiert natürlich in Ordnung. Während der Verdacht, russische Influenzer könnten auf digitalem Weg die Wahlen im Westen beeinflussen, für Empörung sorgen muss – sicher zu Recht, aber warum empören wir uns dann, wenn östliche Staaten sich umgekehrt gegen unzweifelhaft vorhandenen direkten westlichen Einfluss schützen wollen?
Und so weiter. Es lassen sich viele Beispiele dafür finden, dass „die Bleichgesichter mit gespaltener Zunge sprechen“, um einmal einen Ausdruck zu gebrauchen, den ein alter weißer Mann nach einer antirassistischen Ordnungsregel gar nicht verwenden dürfte. Alles hier Gesagte ist für viele ausgeschlafene Zeitgenossen nichts Neues. Die Botschaft dieses Zwischenrufs ist denn auch nur eine Erinnerung daran, welch ein Schindluder mit dem Begriff Demokratie getrieben wird, wenn er als extrem biegsames Propaganda-Schlagwort aus regelbasierten Ordnungstrompeten gestoßen wird, um sich in die Angelegenheiten anderer Nationen einzumischen oder dort gar Krieg zu befeuern.
Da die beschriebenen Entwicklungen von den politischen Mandatsträgern der demokratischen Staaten betrieben werden und nicht unmittelbar den Bürgerwillen ausdrücken, müsste der Spruch heute wohl lauten: „La Democratie, ces sont nous, les mandataires.“ Ist das wirklich so viel besser als „L´etat, c´est moi“?
25.04.2024 Pessimistische Jugend
Eine soziologische Studie „Jugend in Deutschland 2024“ stellt fest, dass die Jugend (14 – 29-Jährige) so pessimistisch sei wie nie. Ihre Sorgen bezögen sich auf zu viel Zuwanderung durch Flüchtlingsströme, Inflation, Kriege in Europa und Nahost, knappen Wohnraum, Spaltung der Gesellschaft – während die Sorgen wegen Klimawandel in ihrer Bedeutung etwas zurückgetreten seien. Parallel dazu sei die Zustimmung zur AfD gewachsen und die Zustimmung zu Regierungsparteien, vor allem FDP und Grünen, die bei den Jungen beliebt waren, zurückgegangen.
Man darf feststellen, dass die Befragten damit eine gewisse Reife und Wachheit dokumentieren, denn die Sorge bereitenden Themen sind ja nicht aus der Luft gegriffen und die Sorgen stehen zum Teil sogar in einer gewissen Opposition zu medial oft anders orientierten Betonungen. Interessanter scheint mir aber die Feststellung zu sein, dass die Befragten sich ohnmächtig fühlen und die Chance zur Einflussnahme als gering einschätzten. Sie beklagen, dass sie unter Stress, Einsamkeit und Ängsten leiden und dass sie ihr Smartphone mehr nutzen als ihnen selbst lieb ist. Ein Drittel bezeichnet das eigene Verhalten dabei als süchtig und bestätigt, dass die Nutzung von Social Media ihr Selbstbild verschlechtert habe. Insgesamt erwarten sie von Gesellschaft und Politik, dass diese ihnen eine gute Work-Life-Balance sichern. Unter dieser Bedingung sind sie auch bereit, ihren Arbeitsbeitrag gern zu leisten.
Diese Befunde sind interessant, weil sie zeigen, dass diese Jugend das Zeitgeschehen aufmerksam und kritisch zur Kenntnis nimmt und in gewissem Umfang bereit ist, für ihr individuelles Leben zu arbeiten – während sie zugleich Resignation hinsichtlich politischer Einflussnahme empfindet, verbunden mit der Erwartungshaltung, dass die Umstände sich doch bitte angenehmer gestalten mögen. Was hier passiert ist ein erschreckender Verlust an demokratischer Souveränität.
Es braucht nicht viel Phantasie, um zu verstehen, was eine wesentliche Ursache dafür ist: nicht diktatorische Maßnahmen versperren der Jugend den Weg ihres Engagements. Sondern mangelndes Vertrauen in die eigene Kraft, Ohnmachtsgefühle, nicht äußere Hindernisse. Eine Ursache nennt die Studie indirekt selbst: Smartphone und Social Media. Das sind Marktplatz und Wohnzimmer dieser Generation. Dort finden unendliche Informationsflüsse und Angebote statt, deren Wahrnehmung pausenlos Zeit kostet und dadurch eigenständige Auseinandersetzung kaum zulässt. Man unterscheidet kaum noch, was Information, was Fake, was völlig sinnlos ist. Es finden oft Beleidigungen bis hin zum Mobbing statt, die nicht wirkungslos bleiben, selbst wenn man sich davon abwendet. Es geschieht systematisch Vereinzelung zulasten direkter „analoger“ Kommunikation. Ein Gefühl für eigene Wirkmöglichkeit in der Realität kann kaum entstehen, weil die aktive reale Erfahrung reduziert ist. Wirkungen scheint es nur im virtuellen Raum zu geben, die Realität ist eine andere Welt.
Hinzu kommt eine Arbeitswelt, die nicht nur „dank“ Corona ebenfalls zur Vereinzelung im Home Office und zunehmend zu digitalen statt persönlichen Kontakten führt. Es ist in dieser Generation der Digital Natives bereits zu echten Fähigkeitsverlusten gekommen, viele können kaum noch mit der Hand flüssig schreiben oder im Kopf rechnen, sondern nur noch über Bildschirme wischen oder Tastaturen betippen, was nachweislich die Entwicklung geistiger und sprachlicher Fähigkeiten einschränkt. Die Entwicklung der „Künstlichen Intelligenz“ (siehe Zwischenruf 12.04.24) bietet in diesem Zusammenhang das Gegenteil von ermutigenden Perspektiven.
Erwähnen kann man noch die Abnahme von Schul- und Breitensport in Vereinen bei gleichzeitiger Zunahme von Besuchen in Fitness Centern, was auch körperlich eine Vereinzelung mit sich bringt. Vielen von diesen kurz angedeuteten Erscheinungen ist es gemeinsam, dass sie nicht nur gemeinschaftliche Aktivitäten aus den persönlichen Zeitfenstern verbannen, sondern dass sie eine Beschleunigung aller Abläufe beinhalten. Nirgends wird das so deutlich wie in den visuellen Medien in Film und Fernsehen (soweit das von dieser Generation überhaupt goutiert wird, aber die Medien versuchen zumindest, sich ihr anzupassen) und natürlich auf dem Smartphone selbst: Immer raschere Bild- und Themenwechsel, kaum ein Innehalten, kaum Konzentration und Geduld herausfordernd, sondern sie geradezu verhindernd. Man könnte die Beobachtungen fortsetzen in den Kulturbereich von Kunst, Musik und Literatur, die aufgrund des ihnen innewohnenden langsameren Tempos zunehmend „veralten“. Wenn ein Projekt zu erfinden wäre, welches Bildung und Aufklärung reduzieren soll, so wäre kaum etwas Effektiveres denkbar als das soeben Beschriebene.
Fazit: digitale Dauerpräsenz mit zunehmender Beschleunigung des Alltags und abnehmenden Gemeinschaftsaktivitäten, Verlust am Erlernen individueller körperlicher und geistiger Fähigkeiten von klein auf führen zu einem Mangel an Fähigkeiten und an Selbstbewusstsein, zu einem Mangel an persönlicher und gemeinschaftlicher Souveränität, zu realen geistigen Abhängigkeiten, also zu dem konstatierten Ohnmachtsgefühl. Der Pessimismus dieser Generation (bzw. von wachsenden Teilen davon!) ist eine logische Folge. Das ist ein Verlust an Demokratie, denn diese ist nur mit individuell fähigen, selbstbewussten und gemeinschaftsorientierten Bürgern möglich. Da könnte man auch als Alter pessimistisch werden. Oder sich für ein anderes Um und Auf für die Jugend bemühen.
12.04.2024 Künstliche Intelligenz
…gibt es nicht. Es gibt künstliche Gedächtnisse, Datenspeicher. Und es gibt anthropogene Algorithmen, also menschengemachte Verknüpfungsbefehle zwischen den Daten. Das ist alles. Aber es ist schlimm genug, wenn man die Datenspeicher und die Algorithmen mit sich alleine lässt, denn ihre Lernfähigkeit erstreckt sich nur auf vorgegebene Wenn-dann-Beziehungen und mathematische Regeln, wie komplex diese auch immer sein mögen, nicht auf eigene Einsichten (Intelligenz), nicht auf datenunabhängige Werturteile. Oder glaubt jemand im Ernst, man könne Ethik logisch-mathematisch erfassen? Und wenn es so wäre: welche Ethik? Die des Konfuzius oder die der Menschenrechtserklärung? Die des Talmuds oder des Korans? Die von Spinoza oder von Kant? Auch die sogenannte Lernfähigkeit von binären Programmen ist nichts anderes als eine vorbestimmte Wenn-dann-Beziehung zur Interaktion mit Benutzern: wenn ein User x-mal dies oder das getan hat, dann reagiere wie folgt… Nichts basiert auf „Einsicht“ der Maschine, alles auf menschengemachten Programmschritten, deren „Lernfähigkeit“ mit dem Projektabschluss des Programmierers beendet ist.
Die Gefährlichkeit von Rechenprogrammen, die zu exekutiven Entscheidungen befähigt sind, besteht in den Konsequenzen, die aus den Datenmengen und den damit verbundenen Rechenschritten folgen können. Die Rechenprogramme haben als tote Maschinen keine eigenen Empfindungen oder Interessen, keine eigenen Motive, Wünsche oder Ängste. Sie geben Antworten auf Fragen unter Berücksichtigung sehr vieler, aber niemals vollständiger und vielleicht sogar fehlerhaft programmierter Randbedingungen. Niemand kann jemals ausschließen, dass eine entscheidende Information oder ein entscheidender Rechenschritt „vergessen“ wurde, einzubauen. Und die Maschinen wissen nicht, was sie tun, wenn man ihnen erlaubt, etwas zu tun. Es ist nicht anders als bei schon lange z.B. im Ingenieurwesen eingesetzten Simulationsprogrammen: Der Anwender muss sowohl die Eingabedaten als auch die dem Algorithmus zugrunde liegende Theorie kennen, um eine Plausibilitätskontrolle durchführen zu können. Die Erfahrung mit diesen vergleichsweise einfachen Rechenprogrammen lehrt, dass bereits kleine Änderungen bei der Dateneingabe oder neue Erkenntnisse, die zu einem etwas anderen Algorithmus führen, entscheidend andere Ergebnisse bewirken können. Ingenieure, die mit Simulationsprogrammen arbeiten, wissen, dass eine „Simulationsgläubigkeit“, die gerne bei Jungingenieuren anzutreffen ist, ohne Plausibilitätskontrolle durch erfahrene Ingenieure keine Entscheidungsbasis sein darf.
Deshalb müssen diese Maschinen bleiben, was sie sind: Diener des Menschen. Ihre Ergebnisse müssen Vorschläge bleiben. Sie können und sollen als Diener, als Hilfsmittel eingesetzt werden, um die Begrenztheit des menschlichen Gedächtnisses und seiner Kombinationsmöglichkeit zu erweitern, aber es muss ihnen verboten bleiben, selbst Entscheidungen zu fällen, die das öffentliche Leben (oder Sterben!) betreffen. Das bleibt die Aufgabe von Menschen, an deren natürliche Intelligenz damit wachsende Anforderungen gestellt werden: denn die Anwender der „künstlichen Intelligenz“ müssen wissen, welche Daten und welche Algorithmen ihrem digitalen Diener eingepflanzt wurden, damit sie seine Antworten auf ihre Fragen einordnen und ihnen folgen können – oder auch nicht, weil der Computer z.B. irgendeine Selbstverständlichkeit nicht „wissen“ konnte. Ohne diese Kontrolle würden wir uns in verantwortungsfreie Abhängigkeiten begeben.
28.03.2024 Fakten statt Panik in der Klima- und Wirtschaftspolitik
Die derzeitige Stagnation der deutschen Wirtschaft fällt in das Ressort des derzeitigen Vizekanzlers. Seine Wirtschaftspolitik steht unter dem Leitmotiv Klimapolitik, wenn auch offensichtlich mit ziemlich unruhiger Hand geführt. Deshalb wird hier noch einmal an ein paar wesentliche Fakten in Sachen Klimawandel erinnert, die es nahelegen, eine ruhigere Hand zu behalten. Ausführlicher wird das Thema unter der Überschrift Klimawandel genauer betrachtet.
Weniger als 1 % der Luftmoleküle haben eine „Treibhauswirkung“. Ohne diese Gase läge die mittlere globale Temperatur aber nicht bei + 15 Grad, sondern eher bei – 15 Grad Celsius. Das verdanken wir CO2, Methan, Lachgas, Fluoriden und Wasserdampf. Letzterer ist quantitativ das wichtigste Treibhausgas, aber praktisch unabhängig von menschlichen Aktivitäten. Rechnet man das schwächere H2O und die stärkeren anderen Gase in CO2-Äquivalente um und unterstellt, dass der CO2-Anstieg seit 80 Jahren komplett anthropogen ist, dann sind heute ca. 10 – 12 % aller Treibhausgase anthropogen. Ca. 10 % davon resultieren übrigens allein aus der Atmung von 8 Mrd. Menschen. Da wir wohl kaum jeglichen Treibhausgasausstoß vermeiden können, reduziert sich unser Einfluss auf wenige Prozentpunkte bezogen auf alle treibhauswirksamen Gase in der Atmosphäre. Das sollte nicht zur Sorglosigkeit, aber zu etwas mehr Bescheidenheit und Ruhe veranlassen.
Nebenbei: manche wissenschaftlichen Quellen verweisen darauf, dass gemäß IPCC-Unterlagen höhere Konzentrationen von CO2 als ca. 300 ppm zu deren relativ abnehmender Treibhauswirkung führen. Das würde der Panik weiteren Boden entziehen; es kann hier aber fachlich nicht angemessen bewertet werden.
Wichtig ist die Beobachtung, dass das CO2 in der Atmosphäre (seit den 1950er Jahren durch eine Station auf Hawaii gemessen) zwar kontinuierlich gestiegen ist, von 300 auf heute 420 ppm; ein leichter CO2-Anstieg hat wohl schon etwas früher begonnen. Der globale (diskontinuierliche!) Temperaturanstieg wird aber seit ca. 1880, bzw. nach neueren Erkenntnissen seit ca. 1860 registriert. Er ist dem CO2-Anstieg vorausgegangen, kann also nicht seine Folge sein. Das ist ganz normal in der Klimageschichte der letzten Jahrhunderttausende: Wärmeres Wasser kann weniger CO2 speichern als kälteres. Wenn es wärmer wird, speichern die Ozeane irgendwann das CO2 aus der Luft nicht mehr ein, sondern geben es an sie ab, was dann sekundär die weitere Erwärmung beschleunigen mag. Die Erwärmung ab 19. Jahrhundert hat in den ersten Jahrzehnten ohne CO2-Anstieg stattgefunden. Die frühe Industrialisierung hat mit ihren ungefilterten Rauch- und Ruß-Emissionen sogar kühlend gewirkt, sodass sie die damals anders verursachte Erwärmung eher gebremst hat. Heute begünstigen die umwelttechnisch sinnvollen Industriefilter tendenziell eine Erwärmung dank der sauberen Luft.
Die Vielzahl der Einflüsse auf das Klimageschehen ist in ihrer Komplexität bis heute nicht völlig verstanden. Es gibt kurz- und langfristige Unregelmäßigkeiten von Sonnenaktivitäten, regelmäßige Umlaufungenauigkeiten unseres Planeten um die Sonne, variable Meeresströmungen u.v.m.. Die Eis- und zwischenliegenden Warmzeiten der letzten Million Jahre hatten eine Temperaturdynamik mit oft mehreren Grad-Sprüngen innerhalb eines Jahrhunderts. Allein nach dem Ende der letzten Eiszeit vor ca. 11.000 Jahren hat es mind. 30mal ein Auf und Ab von ca. 2 Grad gegeben (ohne anthropogenes CO2) – also ungefähr das, was wir heute auch beobachten. Das ist der Normalfall. Es gibt kein stabiles Klima und die Schwankungen waren früher oft stärker und schneller als heute. Das 19. Jahrhundert war eher kühl, während es im Mittelalter und zur römischen Kaiserzeit so warm war wie heute. Als die Landwirtschaft „erfunden“ wurde, war es jahrtausendelang wärmer als heute. Das alles haben Eisbären und Korallen überlebt.
Ich schließe daraus: Natürlich sollen wir unseren CO2-Ausstoß drosseln, aber nicht uns selber dabei erdrosseln. Die größere Aufgabe ist es, sich mittelfristig auf einen etwas wärmeren Globus einzustellen, wie überhaupt auf unbeeinflussbare Klimaschwankungen. Das musste die Menschheit schon immer und es ist ihr früher oft nicht gut gelungen, sondern hat zum Untergang von Kulturen oder ganzen Völkern geführt hat. Bei 8 Mrd. Menschen ist die Aufgabe noch anspruchsvoller. Wir haben heute zwar bessere technische Möglichkeiten als frühere Generationen. Aber wir müssen verstehen, dass wir das Klima nicht so regulieren können als wäre es eine Maschine mit den IPCC-Empfehlungen als Bedienungsanleitung. Wir müssen uns anpassen an Veränderungen. Dazu brauchen wir Frieden und internationale Kooperation statt Machtpolitik und Krieg.
Für die Tagespolitik und auch die mittel- und langfristigen Perspektiven bedeutet das unter anderem: mehr Gelassenheit, Toleranz und Technologie-Offenheit in der Energiepolitik und mehr Friedens- und Kooperationsbereitschaft in der internationalen Politik
21.03.2024 Einstaatenlösung
Der Philosoph Omri Boehm hat gestern den Buchpreis für Europäische Verständigung erhalten.
https://www.tagesschau.de/kultur/buchmesse-leipzig-136.html Zentral dafür war wohl seine Vision für eine Lösung im israelisch-palästinensischen Konflikt. Er sieht eine Zweistaatenlösung als mittlerweile sehr unrealistisch, weil mit zwei ungleich starken Staaten, die dann entstehen würden, keine Gleichheit, sondern weitere Unterdrückung wahrscheinlich wäre. Außerdem habe ein palästinensischer Staat nach den aggressiven Landnahmen der jüdischen Siedler ja praktisch kein lebensfähiges Territorium mehr. Diese Sicht ist sehr verständlich und nachvollziehbar. Boehm plädiert für einen föderalen Staat mit zwei autonomen Nationen in eigenen Territorien auf Basis einer gemeinsamen Verfassung. https://de.wikipedia.org/wiki/Republik_Haifa
Auch das ist sehr verständlich und nachvollziehbar. Es würde allerdings bedeuten, dass der israelische Staat sein Selbstverständnis als jüdischer Staat mit ungleichen Rechten für Juden und Nichtjuden aufgeben müsste. Und es bleibt auch hier offen, welches Territorium ein autonomer palästinensischer Staatsteil beanspruchen dürfte, angesichts der westjordanischen jüdischen Siedlungen.
Insofern ist dieser Vorschlag wohl wirklich eine Utopie – als was er sich ja auch selbst versteht. Aber wenn man schon das Feld der Utopie betreten hat: warum muss man dann noch zwei Nationen innerhalb eines Staates fordern, mit jeweils eigenen Territorien, also auch Umsiedlungen? Etwas ähnliches wurde 1947 (fast zeitgleich mit der Gründung Israels!) in größerem Maßstab auch mit Indien und Pakistan praktiziert: religiös begründete territoriale Umsiedlungen und Souveränitäten – mit bekannten gewalttätigen Folgen bis heute! Warum kann man nicht einen Staat anstreben, in dem alle Bürger unabhängig von ihrer Religion und Ethnie gleiche Rechte und Pflichten und Freiheiten haben? Ja, das ist von den meisten der heute lebenden Israeli und Palästinenser offenbar zu viel verlangt. Aber es ist wohl die einzige Utopie, die im Namen des Friedens und der Demokratie anzustreben ist.
09.03.2024 Aus Opfern werden Täter
Das ist ein seltsames Phänomen. Wer Opfer von Gewalt, Unterdrückung, Diskriminierung etc. geworden ist, sollte eigentlich den Schluss daraus ziehen, dass damit generell Schluss sein muss, wenn es für ihn vorbei ist. Aber nicht selten wird ein Opfer zum Täter, wenn er Gelegenheit dazu bekommt. Elias Canetti beschreibt das auf der individuellen Ebene mit einem „Stachel“, den eine Befehlsunterwerfung setzt, ein Stachel, der weitergegeben werden will. Ähnliches scheint es auch auf der kollektiven Ebene zu geben. Opfer von Massen- oder Völkermord, oder von nationaler Diskriminierung, können zu Tätern werden, so als müssten sie einen Stachel weitergeben. Und zwar nicht notwendig den ehemaligen Peinigern, sondern als generelle Haltung zur Selbstbehauptung.
Ein krasses Beispiel ist die jahrhundertelange Unterdrückung der Juden in der europäischen Geschichte, die im Holocaust durch den Nationalsozialismus ihren Höhe- (bzw. Tief-) punkt erreichte. Aber sie zog die Unterdrückung und Entrechtung eines ganz anderen Volkes nach sich, indem und nachdem der Staat Israel gegründet wurde, was im derzeitigen Völkermord in Gaza kulminiert. Hier müssen keine Details ausgebreitet werden; wer wissen will, weiß, dass Israel von Anfang an und nach eigenem Selbstverständnis ein jüdischer, also kein konsequent demokratischer Staat ist, mit stark verminderten Rechten für die einheimische nichtjüdische Bevölkerung. Und er weiß, dass Israel von Anfang an und kontinuierlich durch seine Geschichte Landraub und Willkür gegenüber den Nichtjuden praktiziert hat. Mit diesen Feststellungen werden umgekehrte Gewalttätigkeiten nicht gerechtfertigt oder bewertet; sondern es wird nur die israelische Aktivität benannt, die mit Vertreibung und Entrechtung von Nichtjuden begann und die in einem Vernichtungswerk gipfelt, welches auch verbal von entsprechenden Absichten begleitet wird. Täter sind dabei nicht nur verantwortungslose Führer, sondern wahrscheinlich eine Mehrheit der Bevölkerung. Wie ist nach einer eigenen kollektiven Vernichtungs-Erfahrung solche kollektive Praxis möglich?
Etwas historisch ganz anderes, aber vielleicht psychologisch ähnliches sehen wir zur Zeit in der Ukraine. Russland war und ist eine politische Macht aus eigener Kraft, die sich aber international oft missachtet gefühlt hat und tatsächlich auch oft angegriffen wurde. Napoleon hat eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Die Hohenzollern- und Habsburger-Kaiser haben das Ende des Zarenreichs maßgeblich mitbewirkt. Die nachfolgende Sowjetunion ist von Hitlerdeutschland nicht besiegt, aber massiv geschädigt worden, was uns Deutsche zu schuldhaftem Gedenken und Respekt vor dem Sieg über die Nazis verpflichtet. Aber auch wenn wir statt dieses Respekts seit 30 Jahren Gelegenheiten zur Ablehnung und Einkreisung Russlands suchen und finden – gäbe es umgekehrt doch Anlass für Russland, aus eigener Erfahrung den Frieden höher zu schätzen als politische oder nationalistische Programme. Aber wir erleben, dass der Kreml die Gelegenheit für günstig hält, mit militärischen Mitteln eine nationale Größe wiederzuerlangen, die Russland früher einmal – ebenfalls mit militärischen Mittlen – erlangt hatte. Auch hier begleiten nicht nur die Reden der Führer, sondern eine mehr oder weniger gleichgültige Zustimmung einer Bevölkerungsmehrheit die Taten.
Natürlich sind die von Russland und von Israel zur Zeit geführten Kriege aus eigener Sicht Verteidigungskriege, wie das ja alle Kriege für sich reklamieren… Und natürlich sind die Argumente dafür nicht frei erfunden. Der abscheuliche Massenmord der Hamas im Oktober 2023 ist durch nichts zu rechtfertigen; die Ausweitung der westlichen Einflusszonen Richtung Russland waren eine machtpolitische Provokation – aber kein Angriff, auch wenn der provozierte Krieg danach durch Waffenlieferungen befeuert wird. Aber beides, der Hamas-Angriff auf Israel und die politische Einflussnahme in der Ukraine rechtfertigen nicht den Völkermord gegen Palästina und sie rechtfertigen nicht den Krieg gegen die Ukraine.
Die Frage an dieser Stelle ist nicht, wen sollen wir unterstützen? Auf welche Seite sollen wir uns schlagen? Sondern meine Frage ist: wie ist es möglich, dass (historisch unterschiedliche) Opfer zu solchen Tätern werden? Müsste nicht gerade eine Opfer-Erfahrung Anlass zu Friedfertigkeit sein? Ich habe keine ausreichende Antwort. Ganz offenbar fehlt es zumindest an einer notwendigen Erziehung zum Frieden. Die militärisch aktive Realität wird diese Fehlstelle weiter aufreißen. Trotzdem rufen in solchen Zeiten manchmal Stimmen zum Frieden, die sonst geschwiegen hätten. Sie müssen lauter werden; welchen Trost, welche Möglichkeit haben wir sonst?
29.02.2024 Politik schlägt Realität
Die Energiepolitik forciert seit über 20 Jahren eine Dekarbonisierung mit dem Argument des anthropogenen Klimawandels: der CO2-Ausstoß muss minimiert, am besten eliminiert werden. Nachdem wegen der Ölkrise bereits seit fast einem halben Jahrhundert die Wärmedämmung bei Neubauten sinnvollerweise verbessert wurde, kam seit fast einem Vierteljahrhundert eine Bewertung des Primärenergiebedarfs hinzu: Bei Baugenehmigungen werden seitdem Hindernisse aufgestapelt, um die fossilen Energieträger zu verdrängen. Diese Hindernisse wachsen dank intensiver Panik-Propaganda inzwischen turmhoch und haben bald Verbotswirkung. Als Alternativen gelten regenerative Energien, also Biomasse und Erd- oder Luftwärme, d.h.: erdgebundene Energieanbauflächen und umfassender Einsatz von elektrisch betriebenen Wärmepumpen.
Unabhängig davon, ob Wärmepumpenbetrieb überall möglich ist oder auch nur ermöglicht werden kann, stellt sich die Frage, ob die regenerativ erzeugte Elektrizität, also Wind- und Sonnenenergie, für die Gebäudeheizung, also vor allem im Winter (!), überhaupt im nötigen Umfang bereitgestellt werden kann. Diese Frage war für die Politik allerdings kein Hindernis, bereits eine praktische Antwort zu geben und alle anderen Energiequellen, d.h. fossile Stromerzeugung, nukleare Stromerzeugung, Kohle-, Öl- und Gasnutzung mit zunehmender Geschwindigkeit aus dem Verkehr zu ziehen. Strom und Wärme werden schon irgendwo herkommen, wenn die Politik das beschließt. Vielleicht aus französischen Atomkraftwerken oder amerikanischen Fracking Gas Lieferungen? Als Übergangstreibstoff gibt es ja noch das Palm- und Rapsöl, mit dessen Erzeugung die überflüssigen Weizenfelder und die unnützen tropischen Regenwälder endlich vernichtet werden…
Als wäre es mit elektrischer Gebäudeheizung noch nicht genug: auch der Autoverkehr wird elektrifiziert. Selbst vorausgesetzt, die für den explodierenden Batteriebedarf erforderlichen seltenen Elemente seien in ausreichendem Maß zu finden und friedlich und sozial verträglich (?!) abzubauen: Wie viele Windrad-Parks und Solarmodulflächen in der Flächengröße wie vieler Bundesländer brauchen wir, um sowohl für die Gebäudeheizung als auch für den gesamten Verkehr annähernd genügend Strom zu produzieren? Und selbst wenn das realisierbar wäre, wird man feststellen, dass das Stromnetz – hierzulande aus gutem Grund unterirdisch verlegt – zusammenbrechen wird. Die bestehenden Netze sind auf die dann gefragten Leistungen für Millionen Wärmepumpen und hunderttausende Ladestationen nicht ausgelegt. Das gesamte Stromnetz in Deutschland muss für diese Abnehmer erneuert werden, was nicht nur Jahrzehnte und zig Milliarden Euro braucht, sondern vor allem die Fachleute, die das praktisch realisieren. Die stehen in Deutschland bei weitem nicht zur Verfügung, außer es regnet plötzlich Tiefbau- und Elektrofirmen. Ein möglicherweise kreativ zu schaffendes „Sondervermögen“ allein baut jedenfalls keine Leitungsnetze; das müssen schon Menschen tun.
Bis zum Eintreten dieses Wunders stellt sich die Frage, wie der Verkehr funktionieren soll, wenn fossil betriebene Pkw und Lkw (!) schon bald nicht mehr hergestellt werden. Ah ja: mit (Elektro-)Bikes, die sowieso schon überall Vorfahrt haben und mit öffentlichen oder auch privaten Nah- und Fernverkehrszügen, die bekanntlich auch keinen Strom verbrauchen. Dazu passt, dass das Schienen- und Zugnetz, wie jeder weiß, gerade massiv ausgebaut wird. Die vielen arbeitslosen Zugführer scharren bekanntlich schon mit den Füßen…
Aller guten Dinge sind drei; setzen wir also noch einen weiteren Stromabnehmer auf die Tagesordnung: die Digitalisierung einschließlich künstlicher Intelligenz. Kaum einer der Protagonisten dieser Zukunftsaufgaben macht sich klar, welcher zusätzliche Elektrizitätsbedarf damit auf die Volkswirtschaft zukommt. Das tägliche Aufladen der Smartphones mag vielleicht noch von der gleichzeitigen Einführung der LED-Technik kompensiert worden sein. Aber mit dem Aufbau von KI, die nicht nur zu Betrügereien bei Schulaufsätzen und Bachelorarbeiten ermuntert, sondern vor allem die ganze Informations- und Kommunikations-Branche bis hin zur produzierenden Industrie auf den Kopf stellen kann, wird ein Stromfresser geschaffen, der es mit dem Energieverbrauch von Leopard-Panzern (für ein paar wenige, aber komplexe KI-Anwendungen!) locker aufnehmen kann. Das Thema Militär und Kriegsführung wollen wir anlässlich dieses Vergleichs im Zusammenhang mit Energie- und CO2-Politik lieber nicht vertiefen.
Aber gemach, gemach: es wird schon alles nicht so schlimm kommen. Denn die Bauwirtschaft befindet sich inzwischen ja auf der Bremsspur dank der politisch gewollten bürokratischen Hürden. Auch wenn diese Hürden und manche Fördertöpfe im Sinne der Echternacher Springprozession (zwei Schritte vor und einer zurück) gelegentlich rückgebaut werden, bleibt die Tatsache fehlender Planungssicherheit bestehen, was auch nicht zu langfristigen Investitionen einlädt. Diese Politik hat aber den unschätzbaren Vorteil, dass dadurch die vielen Wärmepumpen und neuen Elektronetze doch nicht so schnell und so massenhaft gebraucht werden, wie es politisch angekündigt war: welch hinterlistiger politischer Weitblick! Die Knüppel im Baugenehmigungsverfahren sind sozusagen eine flankierende Maßnahme zu den mangelnden Ressourcen beim Elektrizitätsaufbau. Klug eingefädelt! Dass die Wohnungssuchenden dabei zu kurz kommen – sogar das passt ins ideologische Bild; schließlich ist der Wohnraumbedarf pro Kopf in den letzten Jahrzehnten so gewachsen, dass er im Interesse einer nachhaltigen Umweltpolitik wieder reduziert werden sollte. Sicher wird man auch noch andere Wege zur sozialen Bescheidenheit finden, um den Energieverbrauch zu senken… Wenn das keine ausgewogene und zielgerichtete Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik ist!
Kurz: wer alle ideologischen Worte und Taten zusammennimmt, mag für die tiefe politische Weisheit, die in den vielleicht nur vordergründig widersprüchlichen Erscheinungen steckt, dankbar sein. Wem das nicht einleuchtet, der wird allerdings die prophetische Weitsicht eines Schlagers bewundern, der vor fast 40 Jahren „Kinder an die Macht“ gefordert hatte. Sollten wir nicht lieber mal „Ingenieure an die Macht“ fordern? Es müssen ja nicht gleich, wie seinerzeit von Platon gewünscht, Philosophen an der Staatsspitze sitzen, von denen vielleicht auch nicht mehr Realitätssinn zu erwarten wäre als von einigen unserer politisch philosophierenden Volksvertreter. Es würde schon genügen, wenn mehr Menschen mit praktischen Berufserfahrungen und realistischen Konzepten im Sinne des Gemeinwohls Entscheidungen treffen würden.
08.02.2024 Demokratieförderung?
Im März 2023 hat die Bundesregierung dem Bundestag einen Entwurf zu einem Demokratiefördergesetz (DFördG) vorgelegt. Es soll „Vielgestaltung, Extremismusprävention und politische Bildung“ fördern. Klingt gut. Ein Blick in die Zielsetzungen zeigt ausschnittweise zum Beispiel folgendes (ausführlich siehe https://dserver.bundestag.de/btd/20/058/2005823.pdf ):
„Aufgrund der derzeitigen gesellschaftlichen Situation, die eine zunehmende Bedrohung für die freiheitliche demokratische Grundordnung und den gesellschaftlichen Zusammenhalt durch unterschiedliche Formen des Extremismus sowie eine sich in Teilen der Gesellschaft verfestigende demokratiefeindliche und gegenüber staatlichen Institutionen ablehnende Haltung erkennen lässt, ist es aktuell wichtiger denn je, eine tragfeste Grundlage für die Durchführung von eigenen Maßnahmen des Bundes und der Förderung von Maßnahmen Dritter in Form zivilgesellschaftlichen Engagements für die Demokratie zu schaffen. Unter anderem Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus, Islam- und Muslimfeindlichkeit, Queerfeindlichkeit, Frauenfeindlichkeit, Sexismus, Behindertenfeindlichkeit und Extremismen wie Rechtsextremismus, islamistischer Extremismus, Linksextremismus sowie Hass im Netz, Desinformation und Wissenschaftsleugnung und die gegen das Grundgesetz gerichtete Delegitimierung des Staates zeigen die Vielzahl demokratie- und menschenfeindlicher Phänomene auf. Die Regelungen des Gesetzes zielen daher darauf ab, die weitere Verbreitung solcher Phänomene und extremistischer Tendenzen frühzeitig zu verhindern, Radikalisierungsprozesse rechtzeitig zu unterbrechen und damit einhergehend das Bewusstsein für demokratische Werte und demokratische Kultur sowie den gesellschaftlichen Zusammenhalt nachhaltig zu fördern und zu stärken. Die Bekämpfung extremistischer politischer Ansichten und Absichten sowie die Förderung gesellschaftlicher Akzeptanz für den demokratischen Rechtsstaat sind nicht allein Gegenstand gesellschaftlicher Selbstorganisationen, sondern gehören auch zu den Aufgaben des Bundes.“
Die Aufzählung der Probleme macht schon deutlich, dass es hier um eine bestimmte politische Stoßrichtung geht, die nur auf den ersten Blick neutral demokratisch ist. Wie kann zum Beispiel „Queerfeindlichkeit“ und „Wissenschaftsleugnung“ im selben Topf Platz finden? Das geht nur, wenn man die Zweigeschlechtlichkeit der Menschheit als Wissenschaftsleugnung bezeichnet. Und sind Rassismus, Antiziganismus, Frauenfeindlichkeit, Behindertenfeindlichkeit etc. wirklich die aktuellen Themen, die unsere Demokratie bedrohen und ein entsprechendes Gesetz erfordern? Das kann nur glauben, wer mit diesen Themen, warum und wozu auch immer, inhaltliche Propaganda betreibt. Mit solchen Themen wird seit einiger Zeit eine Spaltung und Entsolidarisierung in unserer Gesellschaft betrieben.
Werfen wir noch einen kurzen Blick auf das Gesetzgebungsverfahren. Der Bundesrat hat unter anderem dazu festgestellt:
„In dem gesamten Gesetzentwurf findet sich keine Bezugnahme zum Landesrecht sowie zu den Maßgaben des Subsidiaritätsprinzips wieder. Es bedarf daher entsprechender Ergänzungen an mehreren Stellen, zur Klarstellung der Beteiligung der Länder sowie zur Erläuterung des Verhältnisses von Bundes- und Landesmaßnahmen.“
Was die Bundesregierung zu dem Hinweis veranlasst hat:
„Die Bundesregierung lehnt die Aufnahme einer Bestimmung zur Unterrichtung der Länder über landesspezifische Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung von Programmen und vergleichbaren Maßnahmen ab.“
Kurz: der Bund will sich von den vielleicht politisch unzuverlässigen Ländern nicht reinreden lassen in die Projekte, die er finanziell fördern will. Vorgesehen ist zunächst die Kleinigkeit von 500 Mio. € in einer Legislaturperiode, siehe hier § 8 (2) https://www.netzwerk-courage.de/wp-content/uploads/2023/05/BAGD_Entwurf_DFoerdG.pdf
Und der Bund (zum Teil auch das Land NRW) tut es ja seit längerem bereits auch ohne dieses Gesetz, im Verein mit finanzkräftigen Stiftungen. In diesem Zusammenhang sind Erscheinungen wie die Bürgerräte zu sehen und auch die derzeit massenhaften Demonstrationen gegen rechts, die durch die Aufdeckung einer Verschwörung durch die Aufklärer von „Correctiv“ ins Leben gerufen wurden. Alles Bewegungen „aus der Mitte der Gesellschaft“ heraus, wie Amtsträger bis in höchste politische Ämter hinein gerne öffentlich behaupten. Da sollte man doch genauer hinschauen.
Die Bürgerräte kommen nur dann aus der Mitte der Gesellschaft, wenn man den in mancher Hinsicht durchaus verdienstvollen Verein „Mehr Demokratie“ als Mitte der Gesellschaft sieht. Aber auch das nur mit Einschränkungen, denn die Finanzierung dieser von wenigen Menschen initiierten Bürgerräte geschieht von Anfang an sowohl mit öffentlichen Mitteln als auch mit Mitteln aus Stiftungen wie z.B. Schöpflin, Mercator u.a., was auf dieser Website unter „Bürgerräte“ genauer betrachtet wird. Aktuell wird gerade eine Initiative gegen Desinformation und Fake news ins Leben gerufen, die ebenfalls einen Bürgerrat einbeziehen will – finanziert von dem völlig uneigennützigen und die Mitte der Gesellschaft repräsentierenden Aufklärer „Bertelsmann-Stiftung“ https://www.buergerrat.de/aktuelles/mit-buergerrat-gegen-desinformation/ Wenn das von SPD und Grünen bisher ohne legislativen Abschluss vorangetriebene DFördG schon beschlossen wäre, hätte die arme Bertelsmann-Stiftung sicher noch mehr finanzielle Beinfreiheit für ihre Absichten.
Das gilt auch für andere Initiativen „aus der Mitte der Gesellschaft“, wie z.B. die Recherche-Firma „Correctiv“. Sie hat ein rechtsradikales Geheimtreffen ans Tageslicht gezerrt, das so geheim war, dass die Redakteure dieser Firma im selben Hotel problemlos ein Zimmer mieten, ungehindert aus- und eingehen und von verschiedenen Seiten die Protagonisten fotografieren konnten. Wie sie allerdings an den Wortlaut dessen kamen, was hinter der für sie selbstverständlich verschlossenen Tür des Versammlungsraumes gesprochen wurde, bleibt ein Rätsel. Aber ihren Recherchen müssen wir ja schon deshalb glauben, weil die zitierten Redner bislang nicht widersprochen hätten, was übrigens nur zum Teil stimmt. Eine schwache Quellenangabe.
Und was wurde gesagt? Einige als rechtsradikal bekannte Redner mögen manch Ekelhaftes von sich gegeben haben, das würde nicht überraschen. Im Wesentlichen ging es wohl darum, dass Ausweisungsbeschlüsse gegen Menschen ohne Bleiberecht in Deutschland auch durchgeführt werden. Von völkisch-rassistischen Absichten einiger Redner haben andere Teilnehmer sich distanziert, wenn auch manchmal mit sehr fadenscheinigen Verharmlosungsversuchen – was die Recherche-Firma und ihre politischen Freunde nicht daran gehindert hat, völlig überzogen vor einem neuen 1933 zu warnen und mit Panikmeldungen hunderttausende Menschen zu Demonstrationen gegen demokratisch gewählte politische Gegner der SPD und Grünen auf die Straßen zu locken.
Bei diesen Demonstrationen wurden dem politischen Gegner mindestens so viele Hass und Verschwindens-Forderungen entgegengebracht wie dieser Gegner solche gegenüber Migranten äußert. Bei aller Sympathie für Stellungnahmen gegen Nazis: um bevorstehenden Nationalsozialismus geht es hier und heute nicht. Wem unsere schwache und ideologisch motivierte Regierung nicht gefällt, der kann sie nächstes Jahr problemlos abwählen. Es stehen verschiedene Alternativen zur Verfügung. Aber wem sie gefällt – der will sie offenbar mit medial finanzierten Propaganda-Kampagnen im Amt behalten, wenn es mit normalen demokratischen Mitteln nicht geht. Ja, es gibt auch bei einigen der kritisierten politischen Gegner und bei manchen ihrer Wähler einen Mangel an demokratischem Willen – aber diese Leute führen weder blutige Straßenkämpfe durch wie vor 1933 noch pfeifen sie in ihrer großen Mehrheit auf demokratische Regeln. Schließlich haben wir auch keinen monarchistisch gesinnten Reichspräsidenten, der demnächst einen Hitler zum Kanzler ernennen wird, sondern einen Bundespräsidenten, der sich amtswidrig politisch positioniert und demokratische Konkurrenten öffentlich diffamiert. Darüber sollte man sich Sorgen machen. Denn dadurch werden – wie z.B. in Köln geschehen – andere Amtsträger ermutigt, der fristlosen Entlassung einer städtischen Angestellten zu applaudieren, die bei dem sogenannten Geheimtreffen anwesend gewesen sein soll – ohne dass ihr sonst irgendetwas vorgeworfen wird.
Werfen wir noch einen Blick auf die „unabhängige“ Recherche-Firma Correctiv. Sie wurde 2014 gegründet, finanziert aus dem Stiftungsvermögen eines deutschen Medien-Imperiums (WAZ) und beschäftigt über 60 Personen aus Mitteln von anderen Stiftungen wie Mercator, Schöpflin, Luminate, Rudolf Augstein, open society (Soros) u.a. sowie aus Bundes- und Landesmitteln. Darüber gibt sie selbst Auskunft https://correctiv.org/ueber-uns/finanzen/. Weniger Auskunft gibt sie über ihre Abhängigkeit von Meta (facebook), aber hierzu haben die Nachdenkseiten verdienstvoll recherchiert https://www.nachdenkseiten.de/wp-print.php?p=84691 .
Wir sehen also: Die „Demokratieförderung“ im Sinne eines zeitgeistigen ideologischen Narrativs wird schon ohne das avisierte Gesetz auf den propagandistischen Weg gebracht. Mit Bürgerräten und anderen Medienkampagnen, die von interessierten Stiftungen mit privaten Geldern und von interessierten Politikern mit öffentlichen Geldern finanziert werden, wird an den demokratischen Institutionen vorbei Politik gemacht. Warum werden die für die „Demokratieförderung“ aufgerufenen zig Millionen Euro nicht dafür verwendet, den Grundgesetzauftrag für bundesweite Abstimmungen (Art. 20 GG) und für ein weniger von Parteien beeinflusstes Wahlrecht (Art. 21 + 38 GG) zu erfüllen?
01.02.2024 Demokratie demonstrieren oder praktizieren?
Hunderttausende Bürger demonstrieren gegen rechts nachdem eine Reihe von Politikern, zum Teil gewählte Abgeordnete, sich in einem angeblichen Geheimtreffen mit einigen als rechtsradikal bekannten Personen getroffen haben, um – niemand weiß genau, was – zu besprechen. Dagegen zu demonstrieren ist ein gutes Recht in unserer Demokratie. Dass dabei von nicht Wenigen Transparente getragen wurden, die dem politischen Gegner seine Bürgerrechte absprechen, ihn zum Schweigen bringen oder ausweisen wollen, stellt solche Transparentträger allerdings auf dieselbe Stufe wie die, gegen die sie demonstrieren.
Landauf landab hört man von der Notwendigkeit, sich mit dem politischen Gegner politisch auseinanderzusetzen. Aber wer (außer vielleicht Sahra Wagenknecht) tut es? Diejenigen, die historisch unpassende Vergleiche bemühen und sich über diesen Strohmann dann empören, tun es nicht. Sie wähnen sich als mutige Verteidiger der Demokratie als wäre 2024 eine Wiederkehr von 1932. Der Rechtsstaat wird zur Zeit aber weniger von Wählern einer rechten Partei bedroht als von einem bunten Mainstream, der sich als einziger Träger demokratischer Werte missversteht. Mit dieser Feststellung wird nicht umgekehrt die rechte politische Seite zum Demokratie-Träger geadelt, sondern es wird daran erinnert, dass das politische Spektrum in einer Demokratie breiter sein darf als das eigene Meinungsbild, solange keine Kriminalität oder Verfassungsbruch nachgewiesen sind. Und für solche Fälle haben wir eine Strafjustiz.
Ein Beispiel, das auch für andere steht: In Köln wird eine städtische Verwaltungsangestellte fristlos entlassen, weil sie bei einem Treffen rechtsgerichteter Politiker teilgenommen hat – ohne dass ihr persönlich ein konkreter Vorwurf gemacht wird. Linke und grüne Stadträte applaudieren öffentlich dieser Entscheidung. Wer gefährdet hier den Rechtsstaat? Empören sich dieselben Menschen mit derselben Entschiedenheit gegen deutsche Waffenlieferungen in Kriegsgebiete außerhalb unserer Bündnisstrukturen? Die Älteren unter uns erinnern sich, dass es einmal als Skandal galt, wenn Waffen auch nur in Krisengebiete geliefert wurden! Wo sind die Hunderttausende, die sowohl gegen die Verbrechen der Hamas als auch gegen den Völkermord der Israelis, der durch unsere Waffenbrüderschaft unterstützt wird, demonstrieren? Was sind in diesem Zusammenhang die richtigen Lehren aus den Verbrechen des Nationalsozialismus? Gegen „Rechts“ demonstrieren und die tatsächlich aktive Politik außer Acht zu lassen oder gutzuheißen, ist demokratisch berechtigt, aber alles andere als mutig. Darin zeigt sich eher opportunistisches Mitläufertum und vor allem ein Mangel an historischem Bewusstsein und aktueller Wahrnehmung.
Die gefährlicheren Akteure sitzen in der Regierung. Deren Bereitschaft zur Militarisierung nach außen korrespondiert seit Jahren mit einer Aggressivität gegen den politischen Gegner nach innen – und diese Stimmung wird maßgeblich getragen von einem sogenannt linken politischen Spektrum – bis hinein in die stattfindende angeblich antirassistische Kultur- und Sprachzensur. Dagegen Stellung zu nehmen erfordert mehr Mut und hat mehr Berechtigung als einen Nazi-Popanz zum Hauptfeind zu stilisieren. Es würde genügen, die echten Verfassungsfeinde unter diesen Leuten zu isolieren, sei es durch strafrechtliche Mittel, sei es – man höre und staune: durch inhaltliche Auseinandersetzung mit den Mitläufern, die sich nicht mehr von der politischen Hauptrichtung vertreten sehen ohne deshalb Nazis geworden zu sein. Aber mit Gleichgesinnten auf die Straße zu gehen ist natürlich einfacher als mit Andersdenkenden zu diskutieren.
19.01.2024 Wer vom Ziel nicht weiß…
…kann den Weg nicht haben. Diesen Gedichtanfang von Christian Morgenstern hat mein Vater gern zitiert, wenn auch nicht mit dem religiösen Gedanken, den der Dichter in der nächsten Strophe formuliert. Der Satz ist ja allgemeingültig. Dennoch streben manche Wege auch ohne ein gewusstes Fernziel in eine nicht zufällige Richtung. Dass sie sich dabei oft im Kreis drehen, wie Morgenstern ausführt, kann durchaus der Fall sein. Wir alle bewegen uns im Leben mehr oder weniger bewusst auf ein (oder mehrere) Ziel(e) hin. Der Individualpsychologe Alfred Adler hat den Begriff des Lebensstils geprägt, den ein Kind sich aneignet, um Anerkennung zu erlangen; der Mensch entwickelt in seinen ersten Jahren eine Gangart, die ihn von einem Minderwertigkeitsgefühl befreien soll – dieses Ziel erkennt der Psychologe in den individuell verschiedenen Gangarten, während der Mensch selbst sich oft andere Erklärungen für sein Handeln gibt. Dennoch besteht eine Logik zwischen gewähltem Weg und echtem Ziel des individuellen Lebensstils.
Adler gibt ein Beispiel aus seiner individualpsychologischen Beratungspraxis: „Betritt man ein Zimmer und sieht man, wie ein Mann allerhand merkwürdige Bewegungen an einem Gestell vornimmt, so dürfte man sagen, der Mann sei verrückt, denn warum sollte er solche absonderlichen Bewegungen machen? Begreift man aber, dass der Mann die Absicht hat, oben auf dem Gestell zu sitzen, so muss man alle seine Bewegungen als zweckmäßig ansehen. Vielleicht ist sein Ziel ohne jeden Wert, aber in Bezug auf sein Ziel sind alle seine Bewegungen richtig.“ Dieses Beispiel ist ein gutes Modell für das Verständnis von vielem, was um uns herum geschieht. Das Ziel wird für so selbstverständlich gehalten, dass man sich keine Rechenschaft darüber gibt, sondern man konzentriert sich nur auf den richtigen Weg zum nicht hinterfragten Ziel.
Betrachten wir zum Beispiel das Kriegsgeschehen, das unsere Welt wieder einmal in zunehmendem Maß belastet. Jeder vernünftige Mensch könnte die Bewegungen der Akteure für mehr oder weniger verrückt halten, wenn man einen „gerechten Frieden“ als Ziel unterstellt, den ja alle Parteien für sich beanspruchen. Der Partei der eigenen Präferenz glaubt man das auch gerne. Auf beiden Seiten. So kritisieren hierzulande Demonstranten zum Beispiel Waffenlieferungen in die Ukraine als kontraproduktiv mit Blick auf das Friedensziel; zu Recht, aber ohne Blick dafür, dass es tatsächlich einen russischen Aggressor gibt. Andere kritisieren zu wenige Waffenlieferungen als kontraproduktiv mit Blick auf ein Gerechtigkeitsziel; auch verständlich, aber ohne Blick dafür, dass hinter den Waffenlieferungen andere Interessen stehen als Frieden zu schaffen. Jeder kennt solche Diskussionen (sofern die Meinungsgegner überhaupt noch miteinander sprechen).
Die Auseinandersetzung wäre ehrlicher, wenn man die echten Ziele der Akteure in den Blick nimmt und nicht einfach einen falschen Weg beklagt, weil man stillschweigend falsche Ziele unterstellt. War es denn eine Friedensabsicht des Westens, die Ukraine schrittweise dem westlichen Bündnis anzugliedern und dem russischen Machtbereich auszugliedern? Hat unsere dilettantische Außenministerin nicht in einem Anflug von undiplomatischer Ehrlichkeit verkündet, es sei das Ziel, Russland zu ruinieren? Eine Kritik am falschen Weg zum Frieden geht fehl, wenn sie ein ganz anderes (nur manchmal formuliertes) machtpolitisches Ziel übersieht. Das gilt selbstverständlich auch umgekehrt. Einige meiner Freunde, die ich als intelligent und friedliebend kenne, haben sich entschlossen, Kritik an der Politik unseres Landes mit Kritikvermeidung an der anderen Seite zu verbinden. Russland wird als das angegriffene und verhandlungsbereite Opfer betrachtet, das seinen Krieg leider aus Selbsterhaltungstrieb führen müsse. „Was hätte Putin den tun sollen?“ habe ich von diesen Freunden oft gehört. Die deutlichen Reden der Kremlführung werden von diesen Freunden nur erschreckend selektiv wahrgenommen. Originalton Putin: „Es wird dann Frieden geben, wenn wir unsere Ziele erreicht haben, die Sie erwähnt haben. Lassen Sie uns nun zu diesen Zielen zurückkehren, sie ändern sich nicht. Ich erinnere daran, worüber wir damals gesprochen haben: Über die Entnazifizierung der Ukraine, über die Entmilitarisierung, über ihren neutralen Status.“ (Quelle: Anti-Spiegel 14.12.2023)
Das ausdrückliche Kriegsziel des Kremls ist also ein Regime-change in Kiew mit dem Ziel einer von Moskau bestimmten Politik, denn das immerhin demokratisch gewählte „Nazi“-Personal in Kiew kann ja nur ein Hindernis sein. (Wo ist der Unterschied zu den Aktivitäten der USA, die vorgaben, Länder wie Irak oder Libyen vom Terrorismus befreien zu wollen?) Logisch dazu passt die von Putin in anderen Reden oft beschriebene historische Sicht, gemäß der die Ukraine ohnehin kein selbständiger Staat sei, sondern überwiegend zu Russland gehöre. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass diese Sicht nichts anderes ist als eine Instrumentalisierung im Interesse von Machtpolitik (siehe z.B. Andreas Kappeler – Bibliothek).
Anders als bei der Erforschung eines individuellen Lebensstils durch den Psychologen liegen hier die Ziele gut sichtbar offen auf dem Tisch. Das ist nicht immer so. Manchmal muss der betroffene Bürger sich durch einen Berg von Propaganda graben, um das Richtige zu erkennen. Hier werden Ziele offen ausgesprochen, aber je nach eigener politischer Haltung nicht verstanden. (Diese Haltung wird unter dem Stichwort „Nationalismus“ genauer betrachtet.) Auch das meist nicht ganz so deutlich ausgesprochene Ziel des Westens wird von seinen Anhängern schlecht verstanden. Es geht nicht um die Verteidigung Westeuropas gegen Russland und es geht nicht um Frieden in der Ukraine – dann hätte man z.B. das Verhandlungsangebot im März 2022 nicht abgelehnt – es geht um die Schwächung Russlands. Während es auf der anderen Seite um die Stärkung und Ausweitung Russlands, nicht um seine Selbstverteidigung geht. Inwieweit die von beiden Seiten gewählten Wege im Hinblick auf ihre deklarierten Ziele so zweckmäßig sind wie in dem individualpsychologischen Beispiel Alfred Adlers bleibt angesichts der Zerstörungen und der geopolitischen Neuorientierungen in diesem Zusammenhang dahingestellt. Ethische Grundsätze stehen ohnehin im Abseits. Fest steht aber:
Beiden Seiten Friedens- oder nur Verteidigungsziele zu unterstellen, geht am Beispiel des Ukraine-Krieges an der Sache vorbei, was die Sache perspektivisch nicht einfacher macht. Beiden Seiten geht es um Machtpolitik, um eine vorwärts gerichtete Veränderung des Status quo zu den eigenen Gunsten. Das bestimmt den jeweiligen Weg unter „logischem“ Einschluss von Zerstörungen und hunderttausenden Toten. Nichts ist so berechtigt wie Kritik an diesen Zielen. Nach beiden Seiten. Aber eben: Diese Ziele muss man kritisieren, wenn man die dafür gewählten Maßnahmen, nämlich Krieg als Mittel der Politik, treffen will. Kritik an den kriegerischen Maßnahmen mit Unterstellung von eigentlich friedlichen Zielen, geht ins Leere. Deshalb muss die Kritik an der Kriegsführung schärfer werden: die echten Ziele aller Parteien sind beim richtigen Namen zu nennen! Und die Kritik wird grundsätzlicher, weil sie nicht nur eine Waffenruhe, sondern ein friedliches Zusammenleben trotz Interessengegensätzen als Ziel setzen muss. Und die Kritik wird schwieriger, weil die Friedliebenden per definitionem unbewaffnet sind. Die Tagesordnung ruft nach zivilem „Ungehorsam“, also nach persönlichem Mut und Gemeinschaftsgefühl.
08.01.2024 Demokratie ist kleinteilig, Souverän ist die Bürgerschaft
Souveränität heißt, allgemein gesprochen, dass ein Mensch auf die Entscheidungen Einfluss hat, die ihn betreffen. Im persönlichen Bereich sollte diese Souveränität gegen 100 % tendieren, denn wer sollte, abgesehen von ethischen Grundsätzen, das Recht haben, in meine persönlichen Entscheidungen einzugreifen? Allerdings beginnen hier bereits mit der Ehe, der Familie etc. die Einschränkungen. Da muss man sich einigen, soweit gemeinsame Themen betroffen sind. Da ist nicht nur einer, sondern zum Beispiel das Ehepaar der Souverän.
Im politischen Raum hat die Notwendigkeit zur Einigung und damit die Einschränkung der persönlichen Souveränität einen weit größeren Radius; hier geht es darum, dass eine politische Einheit souverän bleibt hinsichtlich ihrer inneren Angelegenheiten. Sofern von Demokratie die Rede sein soll, ist die Gesamtheit der Bürgerschaft der Souverän. Auch hinsichtlich übergeordneter Angelegenheiten muss diese Souveränität Bestand haben indem Vereinbarungen mit anderen politischen Einheiten unter dem Gesichtspunkt der Vertragsfreiheit stattfinden. Was übergeordnet zu regeln ist, entscheidet jede politische Einheit souverän selbst – unter Beachtung der Gefahr, dass bei zu viel „Übergeordnetem“ die Demokratie verlorengeht und bei zu wenig die Funktionalität. An anderen Stellen dieser Website (Kernthemen und Genauer betrachtet) wird ausführlicher auf die Souveränitätsabgabe der europäischen Staaten an eine Europäische Kommission eingegangen, welche sich keineswegs nur Entscheidungskompetenz für offensichtlich übergeordnete Angelegenheiten anmaßt, sondern im Namen von Effektivität und Konkurrenzfähigkeit nahezu alles für übergeordnet relevant erklären kann, weil die Staaten sie dazu ermächtigt haben.
Abgesehen davon, dass damit Demokratie beiseitegeschoben wird (was bezogen auf die EU manche verschämt als „Demokratiedefizit“ verharmlosen), darf man fragen, ob das Argument der Konkurrenzfähigkeit denn überhaupt stimmt. Gemäß internationalen Rankingagenturen sind Kleinstaaten wie die Schweiz oder Singapur die konkurrenzfähigsten. Bei der Schweiz handelt es sich um ein Musterbespiel direkter Demokratie, bei Singapur zwar nicht im selben Maß, aber immerhin ist der Stadtstaat ohnehin überschaubar. Manche sagen dazu: naja, das sind eben Kleinstaaten, als wären es unbedeutende Staaten abseits der Weltwirtschaft. Tatsächlich hat z.B. die Schweiz aber einen höheren Exportanteil als das Exportland Deutschland und steht unter den sogenannten Industrienationen auf einem Spitzenplatz hinsichtlich seiner Industrieproduktion pro Kopf, beim Wohlstand seiner Bürger sowieso.
Der Zusammenhang von funktionierender Demokratie und Wirtschaftskraft wird auf dieser Website unter Erfolgsmodell Schweiz genauer betrachtet. Die Europäische Union, die politisch vom „Demokratiedefizit“ lebt, schwächelt dagegen international, wobei Deutschland aufgrund seiner immer noch halbwegs föderalen Struktur zu den Stärkeren gehört. Das konkurrenzfähige Riesenland USA, ebenfalls und konsequenter als Deutschland föderal organisiert, lebt als ehemaliges Industrieland allerdings eher davon, dass der Dollar noch immer eine Leitwährung ist.
Was sagt uns dieser kurze Überblick? Demokratie ist wirtschaftlich hilfreich – aber nicht eine Sonntagsreden-Demokratie, sondern eine kleinteilig funktionierende. Anders kann sie gar nicht existieren. Sogar in der Schweiz wurde festgestellt, dass die Zusammenlegung von Gemeinden zu einem Verlust an aktiver Beteiligung durch die Bürger geführt hat. Wenn mein Einfluss in die Entfernung schwindet, verschwinde ich allmählich als aktiver Bürger. Und damit verschwindet demokratische Souveränität. Denn der Souverän ist die Bürgerschaft.
Nur am Rande: natürlich gehört zu der Übersicht, die der Bürger über seine öffentlichen Entscheidungen haben muss, Bildung und ständige Aufmerksamkeit. Aber umgekehrt ist es so, dass in politischen Systemen mit restriktiver Subsidiarität, also mit Zurückhaltung bei der Definition, was übergeordnet zu regeln sei, Aufmerksamkeit und aktives Interesse der Bürger lebendiger sind. Verbunden mit einem seriösen Bildungssystem ist dies der Humus für Demokratie und Wohlstand.
Fazit: die Souveränität muss bei der Bürgerschaft bleiben. Politische Einheiten dürfen Souveränität nicht abgeben, sondern müssen „außenpolitische“ Themen möglichst ab der Gemeindeebene in dauerhafter Vertragsfreiheit regeln. In Deutschland hat das Grundgesetz die Gesetzgebungskompetenz den Bundesländern, die eigene Staaten sind, zugeteilt – mit Ausnahme von explizit genannten Themen, die der Bund zu regeln hat und mit Rücksicht auf explizit genannte Themen, die Bund und Land „konkurrierend“ regeln sollen. Bei diesen zuletzt genannten hat der Bund zunehmend die Regie übernommen und diese dann weiter nach Brüssel delegiert. Hier läge also ein Ansatz, wie im Sinne des Grundgesetzes Souveränität zurückzuholen und Demokratie damit zu festigen wäre. Neben dieser Stärkung des grundgesetzlich gewollten, aber praktisch flüchtigem Föderalismus wären vor allem Reglungen zu echter Gemeindeautonomie zu entwickeln (siehe Genauer betrachtet – Die Gemeinde). Im Übrigen ist zwar gegen neue Parteigründungen, wie sie gerade gestern wieder stattgefunden haben, gar nichts einzuwenden, aber vielleicht wären solche demokratischen „Gehhilfen“ überflüssig, wenn unsere Demokratie direkter organisiert wäre – mit niederschwelligen Abstimmungsmöglichkeiten über alle Gegenstände, die auch unsere Abgeordneten (für uns) entscheiden dürfen, und zwar ohne sich dabei besonders sachkundig machen zu müssen oder auch nur zu können.
19.12.2023 Das Leben verteidigen
Wohl nie hat es global durchweg friedliche Verhältnisse unter den Menschen gegeben. Aber seit einigen Jahrzehnten werden Kriege als Mittel der Politik auch unter denen wieder hoffähig, die sich als Demokraten verstehen und seit wenigen Jahren eskaliert eine Kriegspropaganda und bestimmt die öffentliche Debatte auf eine Art und Weise, als wäre es verantwortungslos, Frieden ohne Waffen schaffen zu wollen – während doch jeder wisse, dass es nur mit noch mehr Waffen geht…
Und zwar auf beiden Seiten. Die einen befeuern die Waffenlieferung der eigenen Seite; sie haben im aktuellen Fall zumindest das Argument, dass die andere Seite, Russland, einen Krieg begonnen hat und ihn konsequent fortführt. Die anderen werben um Verständnis für die andere Seite; sie haben das Argument, dass die eigene Seite vorbereitend aggressiv gewesen war. Etwas mäßigend äußern sich offizielle Stimmen immerhin zu Israel, das den Völkermord als Antwort auf die Hamas-Verbrechen bitte nicht übertreiben möge.
Viele Bürger haben innerlich oder sogar öffentlich Partei für die eine oder andere Seite ergriffen und üben Kritik, sei es verbal, sei es mit Waffen, ausschließlich an der anderen Seite. Was geht da vor? Wo ist die Stimme des Friedens, die nicht im selben Atemzug die andere Seite anklagt, auch wenn es dafür 100 Gründe gibt?
Es gibt solche Stimmen, wenn auch zu leise oder zu wenig medial beachtet. Ein Beispiel sind die Combatants for peace. Die Kämpfer für den Frieden. https://afcfp.org/ Eine Bewegung, die von israelischen Soldaten gegründet wurde, die sich nicht mehr den Befehlen unterwerfen wollten, die nichtjüdische Bevölkerung in Israel und Palästina zu terrorisieren. Sie haben sich entschieden, Frieden zu schließen – nicht irgendwann in der Zukunft, sondern sofort. Sie haben sich entschieden, mit den Palästinensern, die ihre aktiven Feinde waren, zu reden und in Frieden zu leben. Denn auch auf palästinensischer Seite gab es Menschen, die nicht mehr Steine oder schärfere Waffen gegen ihre Besatzer richten wollten, sondern verstanden haben, dass man auch mit dem Feind reden und ihn verstehen lernen kann – und muss, wenn es Frieden geben soll.
Diese Menschen, Israelis und Palästinenser, die in den Kampf gegen einander geschickt worden sind, wissen, wovon sie reden, wenn sie das Ende des Kampfes, die Gewaltlosigkeit, das Verständnis und ein gerechtes gemeinsames Leben fordern. Denn sie waren Teil dieses gewalttätigen Kampfes und haben ihn aufgegeben. Sie haben verstanden und gehandelt. Mit diesem Schritt, der von jedem persönlichen Mut und Opfer fordert, sind nicht alle Probleme gelöst, sondern sie fangen erst an: wie geht das – ein gerechtes Leben? Aber immerhin kann man diese Frage jetzt stellen, wenn man die Waffen niedergelegt hat. Solange man sie in Händen hält, kann man nicht einmal diese Frage stellen. Wie sehr möchte man diese Einsicht, diese Intelligenz auch anderen aktiven Feinden wünschen, seien es Russen und Ukrainer, sei es wer auch immer.
15.12.2023 Wer vertritt mich?
Eine Demokratie ist ohne gewählte Abgeordnete in Entscheidungsgremien, die die Interessen der Bürger dort vertreten, undenkbar. Das gilt auch dann, wenn es umfangreiche Maßnahmen für sachliche Direktentscheidungen gibt. Und es gilt grundsätzlich auch dann, wenn sich in den Entscheidungsgremien aktuell Korruption, Lobbyismus oder Inkompetenz breitmachen.
Eine offenbar nicht korrupte Abgeordnete hat festgestellt, dass die meisten Bürger gar nicht wissen, wer sie in welchem Gremium vertritt und welche Entscheidungskompetenz dieses Gremium hat oder nicht hat. Kurz: sie hat eine große Ferne zwischen Bürger und Institutionen bemerkt und allein schon das als einen Grund für eine sogenannte Demokratieverdrossenheit vieler Bürger vermutet. Dem kann man wohl kaum widersprechen. Je größer die Entfernung zwischen Politiker und Bürger wird, desto weniger werden die Politiker vom Bürger gesehen und kontrolliert.
Deshalb hat Franziska Hollstein mit einem Team eine Plattform ins Leben gerufen, auf der für jeden Wahlkreis auf jeder Wahlebene (Gemeinde, Land, Bund) der/die aktuelle Volksvertreter/in genannt wird und auch die Zuständigkeiten erkennbar sind. https://www.demokratie-wegweiser.de/ Man möchte meinen, dass ein solches Informationsangebot, also praktisch ein Fernglas zwischen Bürger und Politiker, in einer Demokratie selbstverständlich sein sollte, aber tatsächlich bedarf es dazu offenbar einer privaten Initiative, die übrigens mit viel Arbeit verbunden ist – eine weitere Bestätigung für den Titel der Website, auf der Sie sich gerade befinden…
Auf der Website Demokratie-Wegweiser kann man seine eigene oder eine andere Adresse eingeben und bekommt die genannten Informationen geliefert – aber halt: die Daten sind noch alles andere als vollständig. Sie beziehen sich bisher nur auf Nordrhein-Westfalen und enthalten auch hier noch Lücken. Deshalb ist jeder an Demokratie interessierte Bürger aufgefordert, am Aufbau dieser wichtigen Datenbank mitzuarbeiten.
03.12.2023 Wir sind alle Menschen
Ein Vortrag von Frau Sumaya Farhat-Naser macht deutlich, wie man Gewaltfreiheit heute leben kann. Oder muss. Diese christliche Palästinenserin, Tochter einer aufrechten und willensstarken Analphabetin, in Deutschland promovierte Biologin, geehrt mit vielen Preisen wie dem Bruno-Kreisky-Preis, dem Hermann-Kesten-Preis, einer theologischen Ehrendoktorwürde u.a., unterrichtet ihre Landsleute und uns deutschsprachige Menschen in Seminaren und auf Vortragsreisen darin, was es heißt, in Frieden zu leben.
Sie kritisiert die israelische Besatzung ihres Landes und schildert schonungslos, wie das Leben unter der Besatzungsmacht aussieht – aber versucht auch unter widrigsten Umständen das Gespräch zwischen ihren palästinensischen Landsleuten und den jüdischen Nachbarn zu organisieren. Sie ist eine entschiedene Gegnerin von Gewaltanwendung und Korruption – aber weigert sich, gegen die gewaltbereite Hamas und die korrupte Fatah öffentlich Stellung zu nehmen. Warum? Weil wir gerade auch mit denen im Gespräch bleiben müssen! Wie können wir im Gespräch bleiben, wenn wir uns öffentlich distanzieren? Die Forderung nach Distanzierung kommt ja meist von denen, die selbst auf der anderen Seite gewalttätig sind oder dafür Verständnis haben. Unser Stolz und unser Wille zum Frieden verbieten uns aber, das Gespräch mit denen abzulehnen, die auf dem falschen Weg sind. Die Weigerung zur Distanzierung bedeutet nicht, dass wir dem falschen Weg zustimmen, sondern im Gegenteil: dass wir es ernst damit meinen, anderen den richtigen Weg zu zeigen. Denn dafür müssen sie uns zuhören. Aber wenn wir uns distanzieren, hören sie uns nicht mehr zu.
Diese Einstellung erinnert an die Rede von Eugen Drewermann (siehe Zwischenruf vom 22.11.2023), der mit Bezug auf die Bergpredigt davon gesprochen hat, dass wir Böses nicht mit Bösem vergelten dürfen, wenn wir das Gute voranbringen wollen. Darüber hinaus können wir von Frau Farhat-Naser noch etwas mehr lernen: die praktische Fähigkeit, das auch zu tun, den Mut und den Witz, die Menschen anzusprechen, nicht als gegnerische Soldaten, nicht als Propagandisten der Gewalt für die eine oder andere Seite, das ignorieren wir erst einmal, sondern als Menschen. Wenn wir überzeugt sind, dass jeder Mensch einen guten Kern hat und in Frieden mit seinen Mitmenschen leben will, dann brauchen wir „nur noch“ den Mut und die Empathie, jedem Mitmenschen diesen Spiegel auch vorzuhalten. Das wird ihm zu denken geben.
Das ist es, was Frau Farhat-Naser uns lehrt und was in den politischen Debatten bei aller intellektuellen Argumentationskraft sehr oft leider nicht vorhanden ist.
22.11.2023 Löwenherz Friedenspreis
Am 19.11.2023 wurde Frau Prof. Dr. Gabriele Krone-Schmalz der „Löwenherz-Friedenspreis“ der NGO „Human Projects“ in Leipzig verliehen. Über die ca. dreieinhalbstündige Veranstaltung gebe ich folgenden Augen- und Ohrenzeugenbericht.
Der Veranstalter Karsten Enz begrüßt die ca. 150 Anwesenden Gäste im voll besetzten Kupfersaal. Er gibt einen kurzen Ausblick auf den Ablauf des Nachmittags und einen Rückblick auf die früheren Preisträger Eugen Drewermann, Dalai Lama, Michail Gorbatschow und andere. Er spielt kurze Interviewabschnitte mit Helmut Schmidt und Klaus von Dohnanyi ein, in denen diese die Ausdehnung der NATO nach Osten und die Provokation Putins durch Biden kritisieren.
Frau Krone-Schmalz erinnert in einer kurzen Begrüßung an ihre 2017 öffentlich vorgetragene Forderung, dass Krieg kein Mittel der Politik mehr sein dürfe, sondern in die Wüste geschickt gehöre.
Die musikalische Begleitung der Veranstaltung geschieht durch die Gruppe „Musik für den Frieden“, der ca. 60 deutsche und russische Musiker, Sänger angehören, von denen einige anwesend sind und bei der Veranstaltung mehrfach eindrucksvolle Darbietungen präsentieren. Genaueres über diese Gruppe kann man über www.musik-fuer-den-frieden.de erfahren. Außerdem werden im Verlauf des Nachmittags Video-Einspielungen mit bewegenden Antikriegs-Liedern gezeigt.
Der nächste Programmpunkt ist ein Gespräch, das Sabine Schiffers, eine Islamwissenschaftlerin und Professorin in Frankfurt am Main, mit Gabriele Krone-Schmalz und Eugen Drewermann führt. Eugen Drewermann kritisiert dabei die angebliche „Zeitenwende“ von Kanzler Scholz – das sei vielmehr ein Salto mortale zurück in alte Zeiten, so könne man keinen Frieden machen. Es gäbe keinen Weg zum Frieden, der Frieden selbst sei der Weg, anders würde man nie ankommen. Gabriele Krone-Schmalz beklagt die Geschichtsvergessenheit, die sich bei uns breit gemacht habe: Gorbatschow habe uns die Deutsche Einheit auf dem Silbertablett serviert und ein europäisches Haus inkl. Russland bauen wollen, aber der Westen habe die Gelegenheit nur zum militärischen Näherrücken genutzt und verstehe Sicherheitspolitik nur militärisch, nicht partnerschaftlich. Frieden gehe aber nur, wenn man den anderen verstehen wolle und dessen Sicherheitsbedenken ernst nähme.
Nach einer weiteren Musikdarbietung betritt Eugen Drewermann als vormaliger Preisträger die Bühne, um die Laudatio für die heutige Preisträgerin vorzutragen. Es ist nicht ganz leicht, diesen Auftritt wiederzugeben. Der 83jährige Mann steht über eine Stunde lang auf der Bühne ohne auch nur einmal den rechten oder linken Fuß zu bewegen und spricht klar und druckreif ohne einen Notizzettel in der Hand, die Hände manchmal als rhetorische Untermalung für seinen radikalen Pazifismus nutzend. Es ist keine „klassische“ Laudatio auf die Preisträgerin, sondern ein persönlicher, philosophisch-religiöser und politischer Vortrag, der sich natürlich um das Thema dreht, für das Frau Krone-Schmalz geehrt wird. Im Folgenden können nur einige Grundgedanken angesprochen werden, zu denen ich mir unten drei Anmerkungen erlaube.
Er beginnt mit einer Erinnerung an seinen Vater, der gegen Russland gekämpft habe, überzeugt von nationalistischer Propaganda, bis er merkte, dass er den Menschen dort unrecht tue. Er hat die Russen schätzen gelernt und später seinem Sohn vermittelt, dass die russische Seele eine Nachtigall sei. Eugen Drewermann versteht vor diesem Hintergrund die wichtigste Botschaft Jesu: dass man dem Bösen nicht widerstreben solle (Matt. 5,38 ff), denn so könnten wir es nicht überwinden, sondern setzten es nur fort. Wir müssen das Böse „überlieben“, denn Menschen sind von Natur aus nicht so „bipolar“ auf Gut und Böse gerichtet, sondern sie werden von den Kriegsherren erst darauf hin trainiert. Wie viele Tote braucht es noch, um das zu verstehen? Das Problem ist unsere Angst, die uns hindere, unsere Menschlichkeit zu leben. Man kann Kriege nicht gewinnen, sondern nur die Menschlichkeit verlieren. Er schildert mit vielen Beispielen die Aufrüstung auf westlicher Seite, die Angriffsversuche, wie zum Beispiel 1961 als bereits US-Flugzeuge mit Atombomben Richtung Moskau flogen – der Kreml habe eingelenkt und die Katastrophe verhindert1). Die Russen hätten ein besseres Verständnis für das Gut-Böse-Problem, sie nennen die, die wir Verbrecher nennen: die Unglücklichen. Die psychologische Einfühlung in den „Bösen“ habe Dostojewski exzellent dargestellt und in die Literatur eingeführt; auch Tolstoi habe das Thema Krieg hervorragend behandelt. Der ukrainische Schriftsteller Gogol aber habe einen Kosakenroman „Taras Bulba“ geschrieben 2). Bei einem Treffen zwischen Kanzler Schröder und Präsident Putin sei damals in der Stadt Immanuel Kants, (Königsberg /Kaliningrad) ein ernsthafter Friedensplan angeboten worden, der aber von den nach Weltherrschaft strebenden USA abgelehnt worden sei. Unsere jetzige Regierung sei leider völlig falsch unterwegs, Pistorius propagiere Kriegstüchtigkeit und Baerbock wäre mit ihrem erklärten Ziel, Russland ruinieren zu wollen, von einem Kanzler Brandt oder Schmidt längst entlassen worden. Zum aktuellen Krieg Russlands in der Ukraine wird gesagt „ok, der Krieg ist ein Verbrechen“, Russland bekomme jetzt das Gegenteil von dem, was es mal gewollt habe. Aber „wir haben Putin dahingetrieben, wo er jetzt steht.“ 3) Jedenfalls sei ein Frieden in Europa ohne Russland nicht möglich; hierzu wird Oskar Lafontaine zitiert. Die Ukraine, die kulturhistorisch ohnehin keine Einheit sei, solle in Regionen mit mehr Autonomie gegliedert werden und Deutschland müsse raus aus der NATO.
Lang dauernder stehender Applaus.
Frau Krone-Schmalz bekommt den Preis überreicht, dessen finanziellen Wert von 5.000 € sie an die Internationale Liga für Menschenrechte weitergibt. Sie geht in ihrer Dankesrede auf die Schwierigkeiten des Journalismus ein. Sie habe immer gewusst, dass es keine Wahrheit gäbe, da man von verschiedenen Standpunkten immer etwas Verschiedenes sehen könne, sodass man sich der Wahrheit nur annähern könne. Wer einen Berg aus 10 km oder aus 100 m Entfernung sehe, werde ihn unterschiedlich beschreiben. Aber heute sei der Meinungskorridor so eng geworden, dass man sich oft kaum noch um Wahrheit bemühe und Unliebsames unter den Teppich kehre, wo es unkontrolliert weiter wachse. Querdenken war einmal ein Merkmal für Qualitätsjournalismus; heute sei der Begriff verbrannt. Sie freue sich zwar, dass junge Leute sich für wichtige Themen engagieren, wie zum Beispiel den Klimaschutz, bedaure aber, dass in dieser Bewegung das Thema Frieden kaum eine Rolle spiele. Aus Klimaaktivisten müssten Friedensaktivisten werden! Wir brauchen eine Erziehung zum Frieden. Abschließend spricht Frau Krone-Schmalz ihrem Elternhaus Dank aus, in dem es eine offene Gesprächsatmosphäre gegeben habe und ihrem Mann, der ihr stets ein wichtiger Unterstützer gewesen sei. Da der Preis auch eine Verpflichtung sei, werde sie bei der Friedensdemonstration am 25.11.23 in Berlin das Wort ergreifen.
Nach ebenfalls stehendem Applaus und einem kurzen Dank der Vertreterin der Internationalen Liga für Menschenrechte für die Spende wird die Veranstaltung mit einer Videoeinspielung des Hannes-Wader-Liedes „Es ist an der Zeit“, gesungen von Reinhard Mey und Konstantin Wecker, beendet.
Anmerkungen des Berichterstatters:
- Die Kubakrise wurde 1962/63 beendet indem die SU Raketen aus Kuba und die USA Raketen aus der Türkei abzogen – nachdem ein US-Flugzeug von russischer Seite abgeschossen worden war. Beide Seiten wollten einen Krieg verhindern.
- Das ist ein auf den ersten Blick unkritischer Kriegsroman. Gogol hat aber auch Anderes geschrieben, vor allem die Petersburger Novellen, die nach Aussage von Dostojewski Grundlage für alle nachfolgende Literatur von Turgenjew über Dostojewski bis Tolstoi waren. Sollte mit der Bemerkung über Dostojewski und Gogol ein Bild friedliches Russland und kriegerische Ukraine angedeutet werden?
- Hier darf man fragen, ob der Kreml nur deshalb so handeln musste, weil er vom Westen getrieben wurde, ob er also keine eigenen machtpolitischen Ambitionen hat, ob nicht er selbst – so wie jeder von uns – für das verantwortlich ist, was er tut oder lässt und ob die eingangs von Eugen Drewermann vorgetragenen Friedensgebote nicht auch für ihn gelten.
01.11.2023 Auch in diesem Krieg gibt es nur Aggressoren (siehe Zwischenruf 23.07.23)
Ja, Gaza wird zur Zeit plattgemacht als gäbe es nicht auch für den Krieg gewisse Regeln – abgesehen davon, dass Krieg sowieso nicht zu einem „regelbasierten“ Zusammenleben gehören kann. Und ja, die Hamas hat israelische Nachbarn auf bestialische Weise angegriffen. Und abermals ja, das Volk von Gaza lebte – ebenso wie die Menschen auf der Westbank – seit vielen Jahren wie in einem Freiluftgefängnis, abgeschnitten von vielen Grundrechten, die im 21. Jahrhundert selbstverständlich sein sollten. Aus verzweifelter Hoffnung und im Rahmen einer religiösen Tradition hatten die Menschen in Gaza vor 17 Jahren der Hamas politische Macht gegeben, die diese seither nicht mehr aus der Hand gibt. Sie hat sie genutzt, um eine militärische Infrastruktur und ein Waffenarsenal aufzubauen, bei dem man sich fragt, warum der israelische Staat das zugelassen hat. Niemand wird ernsthaft behaupten wollen, dass es unbeobachtet geschehen konnte. Bei allem, was man über die Fähigkeiten des israelischen Staates weiß, muss man annehmen, dass es vielleicht sogar bewusst geduldet wurde, seit die Israelis den Gaza-Streifen verlassen haben. Warum?
Man darf aber auch die Frage stellen, warum Hamas seit 07.10.23 diese Angriffe führt. Niemand konnte auch nur eine Minute lang glauben, dass dem Volk von Gaza damit irgendein Gefallen getan wird. Jeder musste wissen, dass Israel zehnfach zurückschlagen wird (diese Feststellung ist keine Rechtfertigung!). Also warum? Man muss das wohl als ein Selbstmordkommando verstehen, bei dem allerdings nicht die Entscheidungsträger in Katar Selbstmord begehen, sondern „ihr“ Volk in den „Selbstmord“ schicken. Es muss ein Kalkül der Angreifer gewesen sein, das Volk dem Märtyrertod preiszugeben, bei dem aussichtslosen Versuch, das israelische Volk zu vertreiben oder zu vernichten. Ein Hamas-Führer sagte in einem rt-Interview auf die Frage nach dem Warum (sinngemäß), es könne doch nichts Schöneres als den Märtyrertod geben.
So richtig es ist, die Rechte der Palästinenser einzufordern, so sehr muss das zugleich ein Protest gegen die Hamas sein. Und so richtig es ist, für das Selbstverteidigungsrecht Israels einzutreten, so sehr muss das zugleich ein Protest gegen den derzeitigen nahezu totalen Krieg gegen Gaza und gegen die jahrzehntelange Unterdrückung der nicht-jüdischen Bevölkerung sein. Wer diese Selbstverständlichkeit als Antisemitismus denunziert, hat nichts von Demokratie verstanden. Die meisten Menschen, auch in Gaza, in Israel, auf der Westbank, wollen wie überall auf der Welt in Frieden leben. Aber die politischen und religiösen Führer auf beiden Seiten und ihre leider mehr oder weniger große Anhängerschaft können sich ein gleichberechtigtes Leben beider Seiten offenbar nicht vorstellen; am besten sollte die jeweils andere Seite von ihrem Erdboden verschwinden – und dieser Erdboden ist jeweils dasselbe Stück Land.
Eine politische Diskussion, die unter Hinweis auf diesen oder jenen Teil der Vorgeschichte Verständnis für die eine oder andere Seite fordert, führt zu keinem guten Ausblick. Verständnis hat nur verdient, wer Frieden fordert. Bedingungslos. Und wer entweder ein gleichberechtigtes Zusammenleben auf dem von beiden Seiten beanspruchten Land organisiert. Oder eine gerechte Teilung zweier souveräner Länder ohne fortschreitende Landnahme und massive Behinderungen akzeptiert. Solange politische und religiöse Führer das nicht wollen, wird Blut fließen und ziviles Leben nicht möglich sein.
26.10.2023 Wahrlich, wir leben in finsteren Zeiten
Kürzlich habe ich mich in der Buchhandlung eines deutschen Hauptbahnhofs umgeschaut. Unzählige Zeitschriften sind unter verschiedenen Überschriften sortiert. Unter der Überschrift Zeitgeschehen…
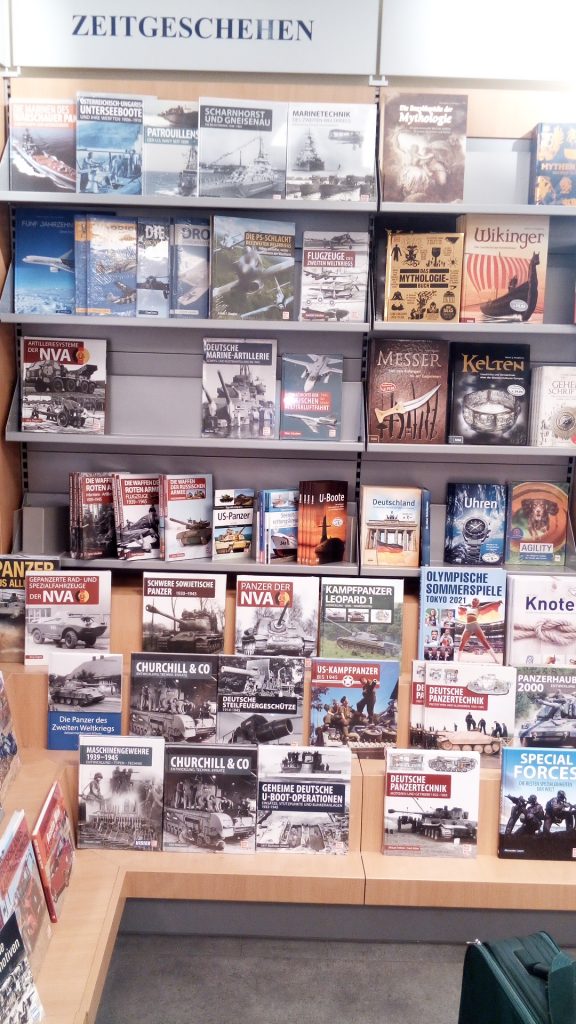
… finden sich fast ausschließlich Hefte über Waffen und Militaria. Das soll also unser Zeitgeschehen sein. Die politischen Machthaber führen Kriege oder beteiligen sich daran. Und das Volk „auf der Straße“ (oder im Bahnhof) interessiert sich dafür und macht gedanklich mit. Nein, gewiss nicht alle. Aber offenbar gibt es genug Nachfrage für dieses „Zeitgeschehen“, für sein Umfeld und seine militärische Vorgeschichte. Geschieht zur Zeit denn nichts anderes, was es wert wäre, wahrgenommen zu werden?
11.10.2023 Neue Weltordnung
Die Anzeichen mehren sich, dass es weltweit Widerstand gegen die „einzige Weltmacht“ gibt, wie ein US-Stratege die USA einmal nannte. Die „Neue Seidenstraße“ verlagert seit einem Jahrzehnt wirtschaftliche Schwerpunkte von China aus nach Eurasien und Afrika – allerdings mit billionenschweren Schuldenlasten für mehr oder weniger arme Länder. In der Ukraine führt Russland seit 20 Monaten einen blutigen Krieg auch und ausdrücklich im Namen einer Neuen Weltordnung. Ja, die westliche Seite hat ihn gern provoziert und führt ihn zulasten der Menschen in der Ukraine und anderswo gerne mit – wohl wissend, dass es für sie um den Erhalt der alten Weltordnung geht. In Afrika putschen Militärs in mehreren Ländern gegen den Fortbestand europäischer Kolonialinteressen – mit fraglichem Ergebnis hinsichtlich einer demokratischen Zukunft. In Palästina greifen religiös-fanatische Machthaber mit iranischer und arabischer Hilfe Israel rücksichtslos an und zwingen auch zig tausend „eigene“ Menschen in einen kollektiven Selbstmord – denn Israels Vernichtungsfeldzug gegen Gaza ist die einkalkulierte Folge: nichts sei schöner als im Kampf für die richtige Sache als Märtyrer zu fallen, sagte ein Hamas-Führer in einem rt-Interview.
Als eine neue globale Macht werden die BRICS-Staaten wahrgenommen, die untereinander alles andere als gleichgerichtete Interessen haben – außer einer Gegnerschaft zum US-Imperialismus – und die demnächst durch die Aufnahme neuer Mitglieder noch heterogener strukturiert sein werden. Was ist da in Zukunft zu erwarten? Wohl weitere Machtkämpfe, sei es gegen die alte Macht, sei es unter den aufstrebenden „Unabhängigkeits“-bewegungen selbst. Machtkämpfe, die so ausgetragen werden wie das aus der Geschichte bekannt ist: erst mit Proklamationen, dann mit Drohungen, schließlich mit Waffen. The rest is silence – sagte der sterbende Hamlet, nachdem er die sinnlosen Machtspiele dieser Welt verstanden und gemeint hatte (to be or not to be?), sich darauf einlassen zu müssen. Entsteht so eine neue Weltordnung?
Oder sind das nicht vielmehr nur Verschiebungen im globalen Machtgefüge – mit all den Blutspuren und Zerstörungen, wie wir sie aus der Geschichte kennen? Müssen wir für irgendjemanden Partei ergreifen, wenn Jungbullen sich mit dem Platzhirsch messen, sei es zunächst nur („wirtschaftlich“) durch Brüllen und Füße-scharren oder sei es (militärisch) durch Geweihkämpfe? Der Vergleich hinkt natürlich, denn anders als bei den Hirschen kämpfen die menschlichen Machtstreber nicht selbst, sondern lassen kämpfen…
Wer an einer neuen Weltordnung interessiert ist, muss nicht Partei für einen der Kämpfer ergreifen – sondern für eine zivilisierte Auseinandersetzung, so unwahrscheinlich das immer sein mag. Aber das Wahrscheinliche kennen wir lange genug. Eine Weltordnung wäre erst dann neu, wenn Machtblöcke verkleinert und nicht vergrößert werden würden; denn mit souveränen „Klein“staaten ohne imperiale Machtinteressen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Interessengegensätze friedlich ausgetragen werden. Das beinhaltet, dass man selbst anfängt mit dem Frieden und nicht auf den anderen zeigt, der – gemäß einem selektiven Blick auf einen Teil der „Vorgeschichte“ – provoziert oder „angefangen“ habe. In der Erziehung von Kindern sind uns diese Regeln selbstverständlich. Bei Erwachsenen und vor allem bei verantwortlichen Politikern ist es offenbar zu viel verlangt…
27.09.2023 Tunnelblicke
Es ist uns Menschen nicht gegeben, alles um uns herum angemessen zu verstehen oder auch nur zur Kenntnis zu nehmen. Jedes Individuum hat je nach Bildungsstand und Charakter einen gewissen Horizont, den es überblickt. Im Austausch mit anderen gelingt es, diesen Horizont zu erweitern, wenn auch nicht bis ins Unendliche, und daraus sinnvolle Schlüsse fürs Handeln zu ziehen. Die Kommunikation in den Gruppen, in denen wir uns bewegen, prägt unsere Wahrnehmung und unser Handeln. Wir haben persönlichen Kontakt in kleineren Gruppen, aber auch Zugang zu unendlich viel mehr Informationen als wir wahrnehmen und verarbeiten können – was für ein Fortschritt gegenüber dem Horizont z.B. eines keltischen Druiden; unendlich und absolut wahr sind unsere Erkenntnisse trotzdem nicht.
Wie soll man sich da zurecht finden? Viele orientieren sich mehr oder weniger an Theoriegebäuden, mit denen sie ihre Weltsicht sortieren. Das ist kaum anders möglich – solange man den Anwendungsbereich und die Grenzen der jeweiligen Theorie im Auge behält. Mit ein paar Beobachtungen möchte ich sowohl zur Bescheidenheit als auch zum „sapere aude“* aufrufen:
Zum Beispiel: „Wirtschaftliche Freiheit schafft Wohlstand, weil der menschliche Erfindungsgeist sich dann frei und tatkräftig entfalten kann. Deshalb sind Begrenzungen dieser Freiheit eine Bremse für positive Entwicklungen aller Art.“ Das ist eine „liberale“ Halbwahrheit – schließlich profitieren nicht alle gleichermaßen von dieser Freiheit, nicht wenige gehen dabei sogar unter. Die Gegenposition ist eine „etatistische“ Halbwahrheit, die dem Staat, also vermeintlich der Allgemeinheit, die Entscheidungsgewalt über das wirtschaftliche Geschehen gibt. Historische Großexperimente im 20. Jahrhundert haben mit bewusst undemokratischen staatlichen Lenkungen zwar einen gewissen Wohlstand, sogar gewisse soziale Gleichheit erreicht, aber auf Kosten einer dynamischen und dauerhaft stabilen Entwicklung. Und auf Kosten individueller Freiheiten. Protagonisten beider Halbwahrheiten hindert das nicht, nahezu alle öffentlichen Probleme mit Mangel an Wirtschaftsfreiheit, bzw. mit Mangel an staatlicher Lenkung zu begründen. Denn das entspricht ihrer Theorie, die sie als Schablone an die Wirklichkeit legen.
Andere historische Beispiele sind drastischer: der Nationalsozialismus fütterte seine Propaganda mit antikapitalistisch durchwachsenem Rassismus. Die Habgier der Reichen, vornehmlich Juden, und das Schmarotzertum der Minderwertigen, ebenfalls Juden, aber auch viele andere, hindere den Wohlstand des überlegenen und allein lebenswerten Teiles der Menschheit. Dieser Tunnelblick „begründete“ nahezu alle Verbrechen und menschenfeindlichen Aktionen der Nazis.
Tunnelblicke sieht man überall, wenn man es wagt, sie sehen zu wollen. Viele, die westliche Demokratien für eine gute Staatsform halten (ich auch), haben kein Problem damit, andere „minderwertige“ Gesellschaftsmodelle notfalls auch mit Gewalt dorthin zu bewegen (ich nicht). In den USA ist es auch heute noch kein Sakrileg, die eigene Überlegenheit als einen solchen Missionsauftrag offen auszusprechen. Und zu praktizieren. Natürlich geht es da offensichtlich nicht um Demokratie-Export, aber die Propaganda funktioniert.
Auf der anderen Seite leiden viele, die solche Propaganda durchschaut haben, an anderen Tunnelblicken. Die berechtigte Ablehnung eines gewalttätigen westlichen Hegemonieanspruches führt bei nicht wenigen zu unkritischer Akzeptanz von Entwicklungen, die man bei klarem Verstand nicht akzeptieren würde. Als gälte nur die Parole: Der Feind meines Feindes muss mein Freund sein. So empören sich viele Gegner der westlichen Kriegsbeteiligung in der Ukraine darüber – nicht etwa, dass der Kreml dort angreift, sondern dass er als Aggressor bezeichnet wird. Als müsste ich für die andere Seite eintreten, wenn ich die eine Seite ablehne. Als hätte die Kremlführung nicht oft genug das Existenzrecht der Ukraine und ihrer ziemlich demokratisch gewählten Regierung in Frage gestellt und damit eigene offensive Kriegsgründe offenbart. Bei vielen Gegnern der US-Hegemonie nimmt man die Demokratiemängel und Machtinteressen der „Gegner“ höchstens mit einem kurzen Seitenblick zur Kenntnis, Hauptsache, es sind Gegner der US-Hegemonie. Das gilt natürlich auch umgekehrt: Welche Schurkenstaaten hat der freie Westen nicht schon als Freunde gehabt und als solche verteidigt, solange es „unsere“ Schurken waren? Das zugrunde liegende Denken wird auf dieser Website unter „Nationalismus“ genauer betrachtet.
Andere Beispiele: Wer einmal von der Klimapanik ergriffen wurde, für den ist jede Überschwemmung und jede Trockenperiode CO2-anthropogen, also vermeidbar und somit ein justiziables Versagen von Politik. Wer einmal verstanden hat, dass unsere Volksvertreter systematisch von Lobbyisten belästigt werden, für den sind auch Corona-Schutzmaßnahmen nichts anderes als ein Vorwand für die Etablierung einer Diktatur. Wer die Rede vom „Tiefen Staat“ missverstehen will (siehe Zwischenruf 14.04.2023), sieht in allen unliebsamen politischen Entscheidungen einen allmächtigen big brother am Werk. Und wer einmal alles Nationale mit bösartigem Nationalismus in einen Topf geworfen hat, der ist auf demokratische Souveränität nicht mehr ansprechbar. Mit offenen Ohren lassen sich unzählige ähnliche Beispiele finden. Nicht alles an manchen Aussagen wird falsch sein, aber nicht jedes Ereignis, nicht jede Aufgabenstellung lässt sich mit einigen Grundaxiomen erklären, die für manche Fälle stimmen mögen – aber für andere nur dann „stimmen“, wenn man „störende“ Informationen beiseite schiebt. Oder gar nicht wahrnimmt oder für Feindespropaganda hält.
Es ist bequem fürs Denken und für die eigene soziale Sicherheit, sich entweder der einen oder der anderen Gruppe – und damit deren mehr oder weniger selektiver und interessengeleiteter oder manchmal auch nur dummer und manchmal zutreffender Interpretation des Geschehens – anzuschließen. Der Wahrheitsfindung zuträglicher wäre es, notfalls auch einmal allein zu stehen mit seiner Sicht der Dinge. Oder vielleicht nur Fragezeichen zu sehen, wo andere allzu rasch Ausrufezeichen setzen. Aber es gibt eine gute Nachricht: jeder kann das ganz allein selbst ändern. Wir haben ein breites Informationsangebot und brauchen nicht einmal viel Mut dafür, es zu nutzen Nur etwas Charakter.
- Immanuel Kant: Wage zu wissen
18.09.2023 Demokratie? Diktatur? wie schwarz oder weiß ist grau?
Von verschiedenen Seiten hören wir in letzter Zeit Abschiedsworte auf die Demokratie, die nun nicht mehr existiere (oder überhaupt nie richtig existiert habe), gerne mit der stillschweigenden Selbstermächtigung, dass man folglich auch nicht (mehr) alle oberflächlichen Formalitäten beachten müsse.
Da gab oder gibt es verschiedene politische Richtungen (nicht nur die „Querdenker“), denen die Corona-Schutzmaßnahmen nicht nur als unbegründete Willkür, sondern als systematische Unterdrückung der bürgerlichen Freiheiten erschienen sind. Da gibt es die „Klimaschützer“, die auf demokratische Verkehrsformen pfeifen, weil mit diesem Bummelzug die Vernichtung der Lebensgrundlagen nicht mehr aufzuhalten sei. Da gibt es die „echten Demokraten“, die sich darüber empören, wenn in einem Parlament jemand an seinem Antrag trotz Unterstützung durch eine „falsche“ Partei festhält. Da gibt es straffreies Mobbing bis hin zu Berufsverboten durch Sittenwächter, die im Namen einer geschlechtergerechten Sprache Unaussprechliches verlangen und Biologiewidriges gesetzlich bestimmen. Schließlich gibt es Politiker, die Kriegshandlungen befeuern, wozu sie gemäß parlamentarischer Mehrheit zwar beschlussfähig sein mögen, große Teile der Bürgerschaft aber dazu gegen sich haben.
Im letzten Punkt sind Zweifel an der demokratischen Qualität des politischen Personals tatsächlich begründet. Wenn ein Staat sich durch Waffenlieferungen und Ausbildung fremder Kämpfer an einem fremden Krieg beteiligt, wäre eine direkte Volksbefragung zu einer solch existenziellen Frage eine Mindest-Voraussetzung. Richtiger wäre es, ein Verbot auch indirekter Kriegsbeteiligungen – außer im eigenen Verteidigungsfall – zur demokratischen Pflicht zu machen. Ich erinnere mich an Zeiten, in denen das zumindest offiziell selbstverständlich war.
Bei vielen anderen Themen beteiligen sich die Totensänger der Demokratie selbst am Schaufeln des Grabes. Auch wenn die Demokratie hierzulande zweifellos durch qualifiziertere direkte Abstimmungen verbessert werden muss (siehe andere Beiträge auf dieser Website); heißt das nicht, dass parlamentarische Mehrheiten deshalb unbeachtlich seien. Verschiedene Bewegungen treten aktuell aber so auf, als müssten die „richtigen“ Entscheidungen auch gegen Mehrheiten durchgesetzt werden. Das betrifft die Kämpfer für „Klimaschutzmaßnahmen“ ebenso wie die Gegner von Corona-Schutzmaßnahmen. Viele der Demonstranten würden ihre Ziele wohl auch gegen Mehrheiten durchsetzen, wenn sie die Macht dazu hätten: Denn immerhin wurde aus diesen Kreisen gegen demokratische Entscheide schon als Ausdruck von Diktatur polemisiert und zum Teil sogar der Respekt vor Mehrheitsentscheidungen in Abrede gestellt.
Demokratiemangel wird zunehmend von denen behauptet, die ihre Minderheitsmeinungen nicht ausreichend durchgesetzt sehen. Sie offenbaren damit selbst einen Demokratiemangel – zumindest im Denken. Und soweit sie deshalb von Diktatur reden, offenbaren sie auch einen Mangel an Bildung und Empathie: Diktaturen zeichnen sich nämlich vor allem dadurch aus, dass sie massiv regulierend in das Privatleben der Bürger eingreifen mit Ge- und Verboten. In echten Diktaturen gab es anlässlich Corona zum Beispiel Impfzwänge und scharfe Ausgangssperren, die es in unserer Demokratie nicht gab. Wer ehrlich ist, findet viele andere Beispiele beim Blick in andere Länder, deren Bürger froh wären, wenn sie unsere „Diktatur“ erleiden müssten – auch wenn es bei uns inzwischen im Energiebereich, bei der Meinungsfreiheit und anderswo zweifellos Beispiele in Richtung Machtmissbrauch gibt. Aber Diktatur ist nicht, wenn demokratische Mandatsträger Machtmissbrauch betreiben, sondern wenn den Bürgern institutionell und/oder praktisch die Möglichkeit genommen ist, darauf maßgeblich Einfluss zu nehmen.
Wenn wir unsere vorhandenen Einflussmöglichkeiten nicht ausreichend nutzen und uns statt dessen über Diktatur beklagen, beleidigen wir nicht nur die Menschen, die in echten Diktaturen leben. Sondern wir eröffnen uns auch keine Perspektive – außer einer, die sich selbst an der Abschaffung der Demokratie beteiligt, weil sie sie nicht achtet.
08.09.2023 Die Wacht des Anti-Nationalismus gebiert Nationalismen
Neulich kamen wir mit einem Bekannten, mit dem ich in einigen Punkten politisch übereinstimme, auf das das Thema Europäische Union zu sprechen. Ich hörte die übliche Rede, das sei ein notwendiges Friedensprojekt; Frankreich sei nun gottlob nicht mehr der Erbfeind; und die rechtsradikalen politischen Bewegungen in manchen Ländern würden doch beweisen, wie notwendig die weitere europäische Integration sei etc. Meinem Einwand, dass die verschiedenen EU-kritischen rechten Bewegungen in Deutschland, Frankreich, Italien (und auch anderswo: England, Ungarn, Niederlande…) gerade eine Folge des EU-Aufbaus seien, nämlich eine Ablehnung des Brüsseler Zentralismus, stimmte mein Gesprächspartner zwar zu. Aber wie passt das zu seiner Argumentation?
Nach dem 2. Weltkrieg wurde intensiv an der Völkerverständigung gearbeitet. Frankreich mit seiner Literatur, seinen Chansons, seiner Küche, seinen Landschaften, seinen politischen Bewegungen wurde hierzulande für Viele zu einem Sehnsuchtsort; in den Schulen wurde Französisch gelernt. Auch Italien oder Spanien und Griechenland kamen dazu, sei es als Familienurlaub am Gardasee, an der Riviera und Costa Brava oder später in Form der Toskana-Fraktion… Nicht alle Vorurteile verschwanden sofort, aber sie nahmen ab, sogar bei meinem Vater, der in jungen Jahren noch freiwillig mit der SS in Frankreich unterwegs gewesen war und sich nun für französischen Wein und Käse begeisterte. Die allmähliche Völkerverständigung geschah im Rahmen von intensivierten Wirtschafts- und Kulturbeziehungen – ohne politische Souveränitätsabgabe. Es war Frieden im Land Europa. Allmählich verschwanden sogar die südlichen Diktaturen. Später dann auch die östlichen.
Dieser natürliche Prozess der Völkerverständigung und Demokratisierung befindet sich schon seit längerem auf dem Rückzug. Und zwar ungefähr seit dem Aufbau der politischen EU und dem gleichzeitigen Ende der SU. Völkerfreundschaft wird immer weniger „an der Basis“ gepflegt, sondern statt dessen überlagert durch mehr oder weniger gewaltsame politische Zusammenschlüsse auf der großen politischen Bühne. Mit gewaltsam meine ich zum Beispiel die Ignoranz gegenüber den negativen Abstimmungen zu einer „EU-Verfassung“ in einigen Ländern oder die klammheimliche Abschaffung nationaler Souveränitätsrechte durch entsprechende Grundgesetzänderungen, die sich eine Mehrheit unserer Bundestags-Abgeordneten Anfang der 1990er Jahre erlaubt hat. Die Folge von inzwischen alltäglichen Gesetzgebungen durch zwei Dutzend nicht demokratisch gewählter Brüsseler Kommissare wird nun mit einer gewissen Verzögerung allgemein wahrgenommen. Aber nicht allgemein goutiert.
Das Wiederaufleben von Nationalismen verlief also nach dieser Friedensperiode mehr oder weniger parallel zur legislativen Ermächtigung einer zentralen Kommission in Brüssel, wo keine Gewaltenteilung bekannt ist (denn das EU-Parlament ist keine Legislative und wird nicht einmal durch gleiche Wahlen gebildet), wo kein „europäischer Souverän“ jemanden ermächtigt hat (denn den gibt es nicht), wo die Richtlinien-Verfasser oft nicht einmal die Sprache der Länder sprechen, für die sie legislativ tätig sind. Sie kennen oft die Rechtssysteme der betroffenen Länder kaum und interessieren sich wenig dafür. Souveräne Gesetzgebung im eigenen Land – und zwar nicht nur für international relevante Themen – wird seit vielen Jahren EU-weit nur noch nur geduldet, wenn sie den Richtlinien aus Brüssel nicht widerspricht. Ist Protest dagegen verwunderlich? Könnte Widerstand nicht vor allem Ausdruck demokratischer Gesinnung sein?
Ja, diese Bewegungen haben magnetisch auf rechtsradikale Kreise gewirkt. Diese haben sich mehr oder weniger lautstark dort eingenistet, auch wenn sie, bezogen auf die Wählerstimmen, zweifellos eine quantitative Minderheit bilden. Denn im zugrunde liegenden Anliegen der Mehrheit kommt ein urdemokratisches Anliegen zum Ausdruck: Wir wollen unsere öffentlichen Angelegenheiten selbst regeln – auch in Form von grenzübergreifenden Verträgen, wo das nötig ist; aber wir wollen nicht alle Details unserer öffentlichen Ordnung von einer fernen Zentrale mit kaum erkennbarer demokratischer Legitimation vorgesetzt bekommen.
Aufgabe von Demokraten wäre es, dem in diesen Bewegungen vorhandenen demokratischen Gedankengut programmatisch in die erste Reihe zu verhelfen – statt die Bewegungen nur für eine Ausgeburt des alten braunen Sumpfs zu halten. Mit dieser selektiven Sicht wird die falsche Seite weiter aufgebaut. Den braunen Sumpf in diesen Bewegungen trockenzulegen gelingt nur, wenn man sich die Mühe positiv-demokratischer Aufklärung macht. Dazu gehört zwingend eine demokratische Kritik an der Europäischen Union einschließlich einer demokratischen Perspektive zu internationaler Zusammenarbeit ohne nationalen Souveränitätsverlust. Ja, das ist anspruchsvoller als das übliche Rechtsradikalen-bashing. Aber nur so könnte man den derzeit inflationären Begriff „Respekt“ mit demokratischem Sinn füllen. Nationalismus-Schelte taugt dafür ebenso wenig wie EU-Propaganda. siehe dazu auch den Zwischenruf vom 05.08.2023
04.09.2023 Nachtrag zur multipolaren Demokratie
Im Anschluss an die abschließende Radio Eriwan-Antwort vom Zwischenruf 01.09.23 könnte man ein historisches Beispiel ergänzen: Mit dem Münsteraner Friedensschluss von 1648 hat es schon einmal einen Versuch gegeben, Frieden im Sinne von Nichtangriffs-Pakten zwischen den europäischen Mächten zu schließen. Die Fürstentümer sollten ihre Grenzen achten und sich gegenseitig in Ruhe lassen – was sie natürlich nicht getan haben. Denn es waren Fürstentümer und keine Demokratien. Und Fürsten haben in der Regel andere Interessen als Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Im besseren Fall wurde die Machtpolitik durch Heiraten bewerkstelligt; das war billiger als Kriege zu führen. Aber „wenn nötig“, musste es eben Krieg sein. Zunehmend herausgehalten aus den europäischen Kriegen hat sich die Schweizer Eidgenossenschaft, auch wenn sich ihre Bürger gelegentlich noch als Söldner verdingt haben.
Übrigens hat der Frieden in Europa nach dem 2. Weltkrieg gut funktioniert, solange es Demokratien und keine mehr oder weniger gewaltsame Zentralisierung durch einen EU-Aufbau bei gleichzeitigem Demokratie-Abbau gab. Seit das geschieht haben nicht nur Kriege in Europa – gegen Nicht-EU-Mitglieder – wieder Platz gegriffen, sondern sogar innerhalb der EU-Mitgliedschaft wachsen auseinanderdriftende Entfremdungen. Innenpolitisch wie außenpolitisch. Man will sich seine politische Identität nicht nehmen lassen. Warum auch?
Heute finden „Eroberungen“ überwiegend durch Handelsbeziehungen, aber auch durch Rohstoff- und Landnahme und zunehmend übrigens durch Raubbau an qualifizierten Arbeitskräften statt, natürlich friedlich. Jeder weiß aber, dass es leider nicht immer friedlich „möglich“ war; das hat die älteste moderne Demokratie in den letzten 100 Jahren ausreichend bewiesen – was Fragen bezüglich ihrer demokratischen Qualität aufwirft. Dürfen wir von den jetzt aufstrebenden global Playern auf Dauer viel besseres erwarten? Sie werden von vielen der ehemaligen Opfer von Kolonisation und Imperialismus gern als Alternative gesehen. Aber auch sie verfolgen eigene Interessen und schaffen Abhängigkeiten. Was berechtigt zu der Annahme, dass hier internationale Beziehungen auf gleicher Augenhöhe praktiziert werden, nach Maßgabe von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, wenn diese Prinzipien innenpolitisch bei diesen neuen Bündnispartnern in unterschiedlicher Weise kaum gelebt werden? Krieg wird ja für eine neue Weltordnung bereits aktiv geführt von Russland nach Westen und vorbereitet von China nach Osten. Beides ist nicht (nur) Verteidigung.
Der antiimperialistische Kampf wurde vor 60 Jahren von einem gescheiterten Revolutionär mit der Parole geführt „Schafft zwei, drei, viele Vietnam!“. Ich würde statt dessen die Parole empfehlen „Schafft zwei, drei, viele Switzerland!“ – natürlich national verschieden, aber ungefähr so genossenschaftlich wie dort.
01.09.2023 Wie demokratisch ist multipolar?
Seit einigen Jahren hören wir von einer entstehenden multipolaren Weltordnung als „Nachfolgerin“ der unipolaren US-Dominanz. Für eine auch heute noch unipolare US-Welt wird gern das 1997 erschienene Buch „Die einzige Weltmacht“ (Originaltitel: The Grand Chessboard) von Brzezinski als Zeuge bemüht, obwohl Brzezinski 15 Jahre später in seinem Buch „Strategic Vision“ selbst ein Konzept für eine multipolare Zukunft vorgestellt hat. Freilich darf man davon ausgehen, dass Großmächte auch eine multipolare Welt nur mit sich selbst als Primus inter pares verstehen wollen.
Scheinbar lassen sich heute alle mehr oder weniger auf etwas Multipolares ein, wobei vor allem den USA unterstellt werden kann, dass dies wohl eher ein neuer Schlauch für den alten Wein ist, wenn man deren Worte und Taten betrachtet. Die interessante Frage ist, ob durch BRICS-Staaten inkl. der bevorstehenden Erweiterung sowie durch die Shanghai Cooperation Organisation und ggf. noch andere Staatenbünde etwas wirklich wesentlich anderes repräsentiert wird.
Natürlich leuchtet sofort ein, dass „flache Hierarchien“ zwischen Staaten und Staatenbünden, also multipolare Strukturen, demokratischer sind als Abhängigkeiten zwischen großen Starken und kleinen Schwachen. Es ist unbedingt zu begrüßen, wenn internationale Vormundschaften abgebaut und durch gleichwertige zwischenstaatliche Partnerschaften ersetzt werden. Aber findet das mit der gegenwärtig auflebenden „Multipolarität“ tatsächlich statt?
Ist von Staaten wie China, Saudi-Arabien, Iran, Ägypten ein Voranschreiten in eine demokratischere Welt zu erwarten? Sind Indien, Russland, Argentinien, Brasilien, Südafrika, Äthiopien mit ihren reichhaltigen Traditionen in Korruption, sozialer Ungleichheit und verschieden ausgeprägten Klassenherrschaften – wenn nicht sogar Kastenwesen bis zu religiös-rassistischen Erscheinungen – bei gleichzeitigem Fehlen demokratischer Traditionen Vorbilder auf dem Weg in eine globale Demokratie?
Natürlich steht es hier nicht zur Debatte, wie andere Völker sich selbst politisch organisieren – sofern es denn tatsächlich die anderen Völker sind, die darüber entscheiden… Sondern hier geht es nur darum, ob oder wie wir in diesem Prozess eine hoffnungsvolle Entwicklung auch für uns sehen wollen. Denn ein Wechsel von der US-Dominanz zu echter Multipolarität wäre ja durchaus wünschenswert. Aber wir müssen die reale Multipolarität genauer betrachten und dürfen nicht der Gefahr erliegen, dass wir wünschenswerte Zukunftsentwicklungen in die Realität nur hineinprojizieren.
Chinas Road & Belt-Initiative, um nur ein Beispiel zu nennen, ist sicherlich eine begrüßenswerte Maßnahme gegen die US-Dominanz, aber dennoch kein selbstloses Projekt für andere. Es gibt von China initiierte sinnvolle Infrastrukturprojekte, aber es gibt ebenso bereits Staaten, die deshalb bei China hochverschuldet – und damit abhängig – sind, zum Teil auch wegen Projekten mit sehr zweifelhaftem Sinn. Es gibt in Südasien und Afrika umfassende Beispiele dafür, dass gewachsene (land-)wirtschaftliche Strukturen massiv gestört werden ohne dass die einheimischen Bevölkerungen Kompensation erleben oder auch nur mitentscheiden dürfen. Kriegerische Expansionen sind von China aus noch nicht zu beobachten, aber Vorbereitungen dafür, z.B. Richtung Taiwan, durchaus. Ein anderer BRICS-Partner – Russland – führt auch im Namen einer besseren Weltordnung nun schon jahrelang blutigen Krieg im Nachbarland. Das zukünftige Mitglied Äthiopien hat kürzlich durch blutige Bürgerkriege inkl. Krieg mit seinem Nachbarland Schlagzeilen gemacht. Die zukünftigen Mitglieder Ägypten und Argentinien sind für ihre korrupten Regierungstraditionen bekannt und Länder wie Iran, Saudi-Arabien und VAR stehen in Sachen demokratischer Strukturen wohl eher auf unteren Ebenen.
Ist von diesen Beteiligten auf der internationalen Bühne etwas zu erwarten, was bei ihnen zu Hause ziemlich unterentwickelt ist? Schön wär´s, möchte man da ganz unterkomplex antworten. Werfen wir doch einmal einen Blick auf uns selbst als Mitspieler; vielleicht bringen wir mit unseren „Werten“ ein demokratisches Gegengewicht ein? Schließlich verlangen auch bei uns nicht wenige sehr zu Recht mehr Unabhängigkeit von der „einzigen Weltmacht“. In diesem Sinne wird zumindest von den maßgeblichen Politikern, aber auch von vielen ihrer Wähler, die Stärkung des europäischen Blocks gefordert, der Verzicht auf nationale Kleinstaaterei etc., um international „mitreden“ zu können.
Ist das die richtige Perspektive? Die EU ist kein Ausweis für eine demokratische Zukunft wie an anderen Stellen auf dieser Website unter Kernthemen und Genauer betrachtet ausgeführt wird. Der Versuch, ein Machtzentrum zu schaffen – ja, das ist die EU. Aber das geschieht auf Kosten der Demokratie, wie man ohne jede Polemik oder Verschwörungsverdacht feststellen darf. Fügt sich das Projekt EU damit nicht bereits wunderbar in eine machtpolitisch geprägte, aber eben nicht demokratische neue Weltordnung ein? Wer soll in dieser vielleicht bald einmal chinesisch oder indisch oder meinetwegen auch EU-dominierten „multipolaren“ Welt die demokratische Fahne hochhalten? Etwa die lupenreinen EU-Demokraten?
Müssten wir nicht vielmehr unsere demokratischen Traditionen und Errungenschaften durch Stärkung der Dezentralität bewahren? Echter Föderalismus auf politischer und wirtschaftlicher Ebene ist die sichere Basis für wirtschaftliche Stärke und politische Unabhängigkeit, was man auch am Vergleich zwischen den Industrienationen Schweiz und (immer noch) Deutschland einerseits und z.B. dem industriell unterentwickelten Frankreich andererseits studieren kann. Zentralisierungen gehen oft nicht nur mit wirtschaftlichem Niedergang (außer für einige Großkonzerne), sondern auch mit demokratischem Verlust einher. Wenn die Multipolarität zu einer besseren Welt führen soll, dürfen die „vielen Pole“ nicht nur neu sortiert und veränderten Machtverhältnissen anders untergeordnet werden, sondern müssen sich selbständig souverän entwickeln und auf Augenhöhe miteinander handeln. Das geht auch in den Außenbeziehungen sicher nur, wenn es in den Innenbeziehungen funktioniert.
Die Frage „Ist multipolar demokratisch?“ würde Radio Eriwan wohl so beantworten: Im Prinzip ja, aber nur in dem Maß, in dem die vielen Pole selbst demokratisch sind.
21.08.2023 Irregeleitete „Selbst“bestimmung
Demokratie ist schön, kann aber auch zu grobem Unfug ermuntern, wenn man den Gedanken selbstbestimmter Souveränität nur individualistisch oder gruppenegoistisch und nicht gesamtgesellschaftlich versteht. Seit einiger Zeit erleben wir selbstbewusst auftretende Menschengruppen oder Individuen, die ihre partikularen Interessen gegen gesellschaftliche Verbindlichkeiten geltend machen. Damit meine ich nicht zu Recht vorgetragene Partikularinteressen, wie zum Beispiel notwendige Forderungen zur sozialen Existenzsicherung benachteiligter Gruppen oder Forderungen von Menschengruppen, die eine bisher verweigerte Gleichbehandlung verlangen, wie zum Beispiel Farbige in den USA, Frauen in vielen Gesellschaften oder Homosexuelle in noch mehr Gesellschaften dieser Welt.
Sondern ich meine Forderungen nach demonstrativem Respekt für Menschen(gruppen), die aufgrund ihrer Selbstdefinition eine angeblich aufgezwungene gesellschaftliche Rolle nicht annehmen wollen. Oder die gegen Unterdrückungsmechanismen kämpfen, welche nur dank intellektueller Anstrengung als Ausdruck früherer gesellschaftlicher Ungleichheiten erkennbar werden.
Als ein Beispiel für das Letztgenannte kann man den Versuch verstehen, die Sprache von ihrer patriarchischen Geschichte zu befreien. Ja, unsere Sprache legt streckenweise Zeugnis von einer männlichen Dominanz ab. Viele allgemein gemeinten Worte haben männliche Formen, auch wenn Frauen mitgemeint sind. Im Englischen ist gar das Wort für Mann und Mensch identisch, während die Frau nur ein Mensch mit Suffix ist. Aber kommt man der Geschlechtergleichheit einen Flohsprung näher, wenn man die Zuhörer und Zuhörerinnen zu unaussprechlichen Zuhörer*INNEn macht? Welcher Mann fühlt sich damit noch angesprochen? Hört und liest man mit derselben Konsequenz auch von Rassist*INNen und Rechtsradikal*INNen? Nein, denn es geht hier nicht um Gleichheit, sondern um eine sich als links verstehende politische Demonstration auf Kosten der Sprache. Man könnte darüber lächelnd den Kopf schütteln …
… wenn nicht eine weitere Etappe dieses Windmühlenkampfes weniger lustig wäre, sondern zeigt, dass es um mehr geht. Es geht darum, die Realität einer unsachgemäßen menschlichen Willkür zu unterwerfen. Die Rede ist von dem aktuellen Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag (SBGG) und die dahinterstehende Geisteshaltung und politische Absicht.
Erwachsene Menschen sollen nach diesem Gesetz frei bestimmen können, welches Geschlecht sie haben, unabhängig davon, welches Geschlecht sie tatsächlich haben. Nein, sie müssen sich deswegen nicht operieren lassen, es genügt, wenn sie „selbstbestimmt“ behaupten: ich bin männlich, weiblich oder keins von beiden. Jugendliche ab 14 Jahren können diese Erklärung zusammen mit ihren Sorgeberechtigen abgeben, oder, wenn diese nicht einverstanden sind, mithilfe eines Familiengerichtes. Für Jugendliche unter 14 Jahren dürfen die Sorgeberechtigten allein diese Erklärung abgeben. Nach Ablauf gewisser Fristen können diese Eintragungen im Melderegister auch wieder geändert werden.
Jeder mag sich selbst ausmalen, welche Folgen im Alltag diese willkürlichen Entscheidungen haben können. Und werden. Man könnte zwar auf die Vernunft der Menschen vertrauen, sich an dieser politischen Kampagne mehrheitlich nicht zu beteiligen. Aber damit ist es leider nicht getan. Denn die politischen Aktivisten sind längst dabei, die Kinder und Jugendlichen systematisch damit zu belästigen.
(zum Beispiel: https://www.welt.de/politik/deutschland/plus247015710/Schule-Nur-eine-Partei-protestiert-gegen-gebaerende-Maenner-Und-Eltern-haben-Mitspracherechte.html )
Lehrer und auch Eltern werden mancherorts schon länger und nun auch mit gesetzgeberischer Autorität dazu angehalten, Kinder und Jugendliche auf ihre Gefühlslage hinsichtlich ihrer Geschlechtszugehörigkeit zu verunsichern – in einer einmaligen Lebensphase, in der es darauf ankäme, sie mit ihrem Geschlecht vertraut zu machen. Das ist das Gegenteil des Bildungsauftrags an Schulen und der Erziehungsverantwortung von Eltern. Manchmal wird rechtfertigend behauptet, bei diesem Gesetz solle es nur um den Schutz der sehr seltenen Menschen gehen, die tatsächlich eine unklare Geschlechtlichkeit haben. Aber warum wird dann die Möglichkeit der Selbstbestimmung auch allen anderen Menschen eröffnet und nicht nur den biologischen Zwittermenschen? Eben: weil es ganz offensichtlich um etwas anderes geht.
Was hat dieses Thema auf einer „Demokratie-Website“ zu suchen? Demokratie steht (oder fällt) mit (nicht) gebildeten selbstbewussten Bürgern. Das sind Menschen, die für sich selbst und für ihre natürliche und gesellschaftliche Umwelt ein angemessenes Verständnis entwickeln konnten und pflegen. Das setzt eine angeleitete Orientierung in verschiedenen Sachgebieten und vor allem eine „menschengerechte“ Persönlichkeitsentwicklung voraus. Denn jeder Mensch ist Teil einer von uns unbeeinflussbaren Natur. Unsere Freiheit besteht darin, das zu erkennen, um dann im Rahmen unserer Möglichkeiten gestalterisch für unser eigenes Leben und für das unserer Umgebung tätig werden zu können. Je größer meine Ignoranz gegenüber den natürlichen und vorgefundenen Gegebenheiten ist, desto mehr wird meine Tätigkeit eine (selbst)zerstörerische und keine konstruktive sein. Wenn die Persönlichkeitsentwicklung gestört wird, was aufgrund vieler Irrtümer im Erziehungsbereich leider sowieso häufig genug und aus Versehen geschieht, diese Störung aber einem systematischen Konzept folgt, dann ist das ein Angriff auf die Bildung freier selbstbewusster Bürger und damit auf die Demokratie.
Das Selbstbestimmungsgesetz zur Geschlechtsidentität ist ein vorläufiger (?) Höhepunkt einer destruktiven politischen Kampagne. Die Verunsicherung bereits von Kindern und Jugendlichen hinsichtlich ihrer persönlichen Identität ist ein Meilenstein auf dem Weg zur propagandistischen Fremdbestimmung. Denn die Geschlechtsentwicklung ist ein sehr wichtiger und sehr empfindlicher Teil der Persönlichkeitsentwicklung. Jeder junge Mensch muss hier behutsam auf seine natürliche Geschlechterrolle vorbereitet werden, natürlich mit Respekt auch vor homosexuellen Neigungen, damit er /sie ein selbstbewusstes und konstruktives Individuum werden kann. Die heute behaupteten zahlreichen angeblich existierenden Geschlechtlichkeiten würden einem Kind oder Jugendlichen nicht einmal im Traum einfallen. Sie damit zu belästigen grenzt an sexuellen Missbrauch und ist etwa so, als gösse man einer Blume Essig statt Wasser an die Wurzeln. Die jungen Menschen werden in ihrer Gefühlsentwicklung verunsichert, misstrauisch gegenüber ihrem natürlichen Gefühl und so konditioniert, dass sie später auch andere Unsinnigkeiten, die an sie herangetragen werden, bereitwilliger für reale Probleme halten. Er /sie verliert Vertrauen in das natürliche eigene Gefühl und wird nicht nur als Individuum in der Persönlichkeitsentwicklung geschädigt, was schlimm genug ist, sondern damit auch besser manipulierbar für andere politische Kampagnen gemacht. Was könnten sich diktatorische Herrscher Besseres wünschen?
05.08.2023 Nation ist kein Verbrechen
Man muss vorsichtig sein, wenn man heute dem Begriff Nation etwas Positives abgewinnen will. Ich setze aber auf die Intelligenz und Sachorientierung meiner Leser und tue es trotzdem, wohl wissend, dass alles was in diesem Zusammenhang assoziiert wird, rasch unter Begriffe wie Rassismus, Ausgrenzung, Fremdenfeindlichkeit, Menschenverachtung, Rechtsradikalismus etc. untergeordnet wird. Ja, Menschen mit solchen Haltungen beziehen sich auch positiv auf Nationales. Ich halte es aber für erschreckend fehlgerichtet, bösartigen Nationalisten dieses Feld zu überlassen.
An anderen Stellen dieser Website wird das Thema ebenfalls angesprochen, bei dem Button Kernthemen unter „Nationale Vielfalt“ und „Europäische Union“, bei dem Button Genauer betrachtet unter „Vereinigte Staaten von Europa“, „Nationalismus“, „Freund und fremd“. Auch in anderen Kapiteln steht einiges dazu zwischen den Zeilen. Im Folgenden sollen ein paar Gedanken konzentriert zusammengefasst werden.
Der Begriff Nation wird manchmal verkürzt mit souveräner Staatlichkeit identifiziert, etwa, wenn im Rahmen von EU-Entscheiden die „nationalen Sonderwege“ kritisiert werden. Kulturgeschichtlich verstehen sich Nationen aber oft nicht identisch mit Staatsgrenzen. Dazu gibt es zahlreiche, auch aktuelle Beispiele. Katalonien strebte zeitweise nach nationaler Unabhängigkeit, ebenso wie Schottland; Südtiroler haben es noch vor gut 60 Jahren auch mit Waffengewalt getan, ebenso wie Nordiren, spanische Basken und andere, teilweise sogar mit guten Gründen. Belgien ist ein Musterbeispiel für einen Staat, der sich nicht als Nation versteht. Und der Ukrainekrieg wird von russischer Seite unter anderem mit falschen Staatsgrenzen hinsichtlich nationaler Identitäten begründet. Willkürliche Staatsgrenzen, die wenig mit Kulturräumen, bzw. gewachsenen Nationen zu tun haben, sind z.B. in Afrika und Teilen Asiens fast die Regel.
Heißt das aber, dass Staatsgrenzen als Markierung von Rechtsräumen generell aufzuheben seien? Oder dass sie entlang von irgendwie definierten Kulturräumen neu zu ziehen sind? Wie sollte im ersten Fall – Paradebeispiel Europäische Union – ein demokratisch organisierter Rechtsraum funktionieren, in dem die Bürger nicht nur das Gefühl, sondern die Realität der Selbstbestimmung inkl. gerechter Gewaltenteilung haben? Wie und durch wen sollten im zweiten Fall neue Grenzen gezogen werden, ohne dass permanente Kriege die Folge wären?
Wer an Demokratie interessiert ist, sollte die Staatsgrenzen so lassen wie sie sind, außer die Beteiligten einigen sich mehrheitlich friedlich auf etwas anderes. Er sollte auch die Souveränitätsrechte in diesen Einheiten belassen, denn zur Souveränität gehört es, dass man mit anderen Partnern kooperieren, Verträge schließen kann, über gleiche Gesetze, über gemeinsame Projekte, über alles… ohne dass man dafür seine Selbstbestimmung aufgeben muss. Man behält dann auch die Freiheit, das eine oder andere Projekt wieder zu beenden, wenn der Souverän, die betroffene Bürgerschaft, das so will. Wer entscheidet aber im Fall der Souveränitätsabgabe? Eine ferne Zentrale, deren Entscheidungsträger vielleicht nicht einmal die Sprache des Landes verstehen, für das sie entscheiden?
Frieden und Demokratie erfordern dezentrale souveräne Einheiten, die nur nach dem Subsidiaritätsprinzip Entscheidungsbefugnisse delegieren. Soweit Nationen als kulturgeschichtliche Räume nicht mit Staatsgrenzen übereinstimmen, lassen sich immer auch innerstaatliche Autonomieregelungen finden, wenn man will. Man mag diese staatlichen Rechtsräume oder auch nicht staatliche Kulturräume Nationen nennen oder anders, wenn einem dieser Begriff von der deutschen Geschichte zu belastet erscheint. Aber die Belastung durch die deutsche Geschichte darf nicht dazu führen, dass man mit der Nation auch die Selbstbestimmung, also die eigene Rechtssetzung und Rechtsprechung abgibt. Mit einer Entsorgung einer als Nationalismus diffamierten demokratischen Souveränität würden wir gerade diese entsorgen. Diesen Gefallen sollten wir den antidemokratischen Nationalisten nicht tun.
28.07.2023 Ziel verfehlt und doch getroffen
Politische Propaganda und Wahrheitssuche rudern selten in dieselbe Richtung. Dabei werden oft ähnliche Denkvermeidungsfiguren auch mit unterschiedlichen propagandistischen Absichten verwendet. Ein Musterbeispiel ist der „Antisemitismus“. In Deutschland wird sehr zu Recht Wert darauf gelegt, dass die Menschen jüdischen Glaubens und jüdischer Kultur gegen Beleidigungen und Angriffe geschützt werden. Dieses Anliegen wird jedoch nicht selten missbraucht, um Kritik an der Politik des israelischen Staates zu vermeiden. Und zwar dann, wenn nach der Versicherung, dass Kritik selbstverständlich möglich sei, diese, kaum ausgesprochen, mit dem Verdacht auf einen Antisemitismus des Kritikers diskreditiert wird: Gespräch beendet bevor es begonnen hat. Jeder kennt diese Gesprächsfigur aus Talkshows oder dem persönlichen Bereich.
Ähnliches gibt es aber auch bei anderen Themen, wenn auch weniger auffällig. Zur Zeit kritisieren manche öffentlichen Stellungnahmen die deutschen Waffenlieferungen in das ukrainische Kriegsgebiet – meines Erachtens sehr zu Recht und viel zu selten. Manche der Kritiker verbinden das mit einem allgemeinen Verständnis für die russische Seite, da der Westen ja sowohl aktuell als auch historisch provokative und völkerrechtswidrige Taten gegenüber Russland begangen habe, was zweifellos stimmt. Manchmal wird diese Stellungnahme gegen die westliche Politik aber auch mit einem mehr oder weniger undeutlich ausgesprochenen Verständnis für die russische „Spezialoperation“ verbunden.
In diesem Zusammenhang geschieht es, dass der Kritik am russischen Angriff mit einer „Russophobiekeule“ begegnet wird. Wer den russischen Angriffskrieg entschieden kritisiert, leidet in den Augen dieser Leute vielleicht an einem tief in der Geschichte verwurzelten Russenhass (bzw. wörtlich: Russenangst) – so wie Kritiker der israelischen Politik wahrscheinlich an einem tief verwurzelten Antisemitismus leiden. Gespräch auch hier beendet bevor es begonnen hat.
Zwar stimmt es, dass weitherum eine irrationale Ablehnung alles Russischen bis hin zur Musik von Tschaikowsky stattfindet als sei die russische Kulturgeschichte für die Kremlpolitik verantwortlich (ausgerechnet Tschaikowsky, der aus zeitgemäßer LBGTQ-Sicht ja vor Diskriminierung geschützt werden müsste!). Aber ist man umgekehrt russophob, wenn man den vom Kreml geführten Krieg beim Namen nennt und kritisiert? Interessanterweise wird die Denkvermeidungsfigur „Russophobie“ hauptsächlich von denen verwendet, die ihrerseits oft Opfer der Antisemitismuskeule sind. In beiden Fällen werden die Kritiker persönlich getroffen und zum Schweigen gebracht, statt dass vorurteilsfrei über die Sache gesprochen wird.
23.07.2023 In diesem Krieg gibt es nur Aggressoren
Kriege werden seit über 50 Jahren nicht mehr offiziell erklärt und auch kaum noch mit Vertrag beendet. Man praktiziert Waffengänge und Zerstörungen als seien es selbstverständliche Bestandteile von Politik. Da waren selbst die „Kabinettskriege“ des 18. und 19.Jahrhunderts zivilisierter. Auch der Krieg in der Ukraine ist – aus Sicht eines Akteurs – nur eine „Spezialoperation“. Völkerrechtlich gibt es zwar einen Aggressor und einen Verteidiger, denn der Krieg findet auf dem Territorium der Ukraine statt. Trotzdem sind nur Aggressoren zu erkennen, wenn man genauer hinschaut.
Die ukrainischen und befreundeten westlichen Regierungen haben seit 2014 völkerrechtlich vereinbarte demokratische Entscheidungen für mehr Autonomie in der Ostukraine („Minsk“) verhindert und statt dessen gewaltsame Behinderungen der dortigen russischsprachigen Bevölkerung durchgesetzt. Das waren keine militärischen, aber massive zivile Angriffe. Auf diese Provokation haben Teile des ukrainischen Militärs mit einseitiger Autonomieerklärung für den Donbass reagiert und diese militärisch durchzusetzen versucht – mit mehr oder weniger verdeckter Hilfe durch den Kreml. Damit begann die militärische Auseinandersetzung, auf die Kiew seinerseits massiv militärisch reagiert hat. Es folgten acht Jahre lang bewaffnete Auseinandersetzungen, die man nicht als Bürgerkrieg bezeichnen kann, weil sie zwischen Teilen des ukrainischen Militärs stattfanden, unterstützt von Waffenhilfe aus Russland einerseits und finanzieller amerikanischer Hilfe andererseits. Nach dem Beginn der russischen „Spezialoperation“ 2022 hat Kiew dann zwar zuerst einer Verhandlungslösung zugestimmt, diese Zustimmung aber auf Druck seiner westlichen Verbündeten wieder zurückgezogen.
Seitdem führt die NATO „verdeckt“ Krieg in der Ukraine und auf deren Rücken, nicht in, aber gegen Russland. Diplomatische und intellektuelle Leichtgewichte wie die deutsche Außenministerin machen aus ihren martialischen Absichten kein Geheimnis und verhalten sich entsprechend. Die Ukraine wird zunehmend mit Waffen versorgt, was man für eine berechtigte Unterstützung ihrer Verteidigung halten könnte, wenn man die vorangegangenen Provokationen, Völkerrechtsverletzungen und Verhandlungsabbrüche ignoriert. Aber auch umgekehrt kann nicht von Verteidigung gesprochen werden:
Wer darauf hinweist, dass der Krieg ja nicht erst 2022, sondern schon 2014 begonnen habe mit militärischen Angriffen gegen den Donbass durch ukrainisches Militär, darf den vorangegangenen bewaffneten Separatismus durch andere Teile des ukrainischen Militärs nicht vergessen. Solches würde kein Staat hinnehmen und auch die betroffene Bevölkerung ist von den Separatisten nicht gefragt worden, ob sie Teil und Opfer eines solchen Krieges werden möchte. Dieser „Bürgerkrieg“ von abtrünnigem ukrainischem Militär wäre gewiss keine acht Jahre lang ohne mehr oder weniger verdeckte russische Kriegsbeteiligung möglich gewesen; das ist jedem klar, der einen Blick auf die Landkarte wirft. Nicht nur Kiew führt mit westlicher Hilfe in der Ostukraine seit 2014 Krieg, ukrainische Truppen selbst haben mit russischer Hilfe seit 2014 Militäraktionen gegen die Zentralmacht begonnen. Das ist keine Rechtfertigung, für niemanden, sondern eine Beschreibung.
Die Aktionen des Kremls könnte man höchstens dann wohlwollend als präventive(!) „Verteidigung“ Russlands verstehen, wenn ein Angriff der Ukraine oder der NATO auf Russland bevorgestanden hätte. Das war aber nicht der Fall und es wird selbst von Militärexperten, die sehr NATO-kritisch eingestellt sind wie z. B. Scott Ritter, deutlich in Abrede gestellt; demnach sei die NATO (und erst recht die Ukraine) auf absehbare Zeit weder in der Lage noch willens gewesen, Russland militärisch anzugreifen. Und es geschieht bis heute nicht.
Zweifellos hat der Westen seit langem einen Wirtschaftskrieg und auch einen politischen Krieg gegen Russland geführt. Es gab und gibt völkerrechtswidrige Sanktionen und ebenso unnötige wie provokative Aufnahmen russischer Nachbarn in die NATO. Es gab einen finanziell und personell unterstützten prowestlichen Putsch in Kiew. Man stelle sich vor, russische Regierungsmitglieder hätten zum Beispiel bewaffnete Rassenunruhen in den USA finanziell mit Milliarden $ unterstützt, also befeuert, und an Demonstrationen dort teilgenommen – so wie der damalige US-Vizepräsident Biden persönlich auf dem Maidan erschienen ist. Die massive US-Einmischung in Kiew 2014 ist eine Tatsache, deren internationale Folgen einkalkuliert, wenn nicht gewollt waren. Wer das verneint, erklärt das Personal im Weißen Haus in Washington D.C. für verantwortungslos kurzsichtig.
Aber ist ein provozierter militärischer Einmarsch Russlands in die Ukraine deshalb eine zwingende oder auch nur eine berechtigte Folge? Ist unschuldig, wer sich provozieren lässt? Hätte der Kreml die westlichen Sanktionen vielleicht auch mit eigenen Sanktionen ohne Krieg beantworten können? Hätte es ohne den russischen Einmarsch einen jahrelangen Krieg mit hunderttausenden Toten und Geflüchteten, zerstörten Städten und Landschaften, lebendigem Hass auf Generationen hinaus und einer vertieften Spaltung Europas und der Welt gegeben? Hätte es all das oder Schlimmeres ohne den Einmarsch gegeben? Wer unterstellt, diese Folgen seien nicht absehbar gewesen, erklärt das Personal im Kreml für verantwortungslos kurzsichtig. Zum Zeitpunkt des Einmarsches gab es in Kiew übrigens eine demokratisch gewählte Regierung, die vom Kreml allerdings als faschistisch und illegitim bezeichnet wurde und wird und deren Beseitigung als ein Grund für die Militäraktionen angegeben wird.
Das Argument, Russland in seinen heutigen Grenzen habe sich verteidigen müssen, wird übrigens vom Kreml selbst kaum bemüht. Noch vor zwei Monaten bestätigte Putin auf einer Petersburger Konferenz, dass Russland nicht existenziell bedroht sei. Der Kreml begründet seine Spezialoperation vielmehr mit der Wiederherstellung einer russischen Einheit, zu der aus Kreml-Sicht auch Teile der Ukraine gehören, die vom westlichen / faschistischen Joch befreit werden müssten. Durch diese Brille betrachtet handelt es sich tatsächlich nicht um einen Einmarsch, sondern um die Verteidigung eines als größer verstandenen Russlands, das zur Zeit leider zu enge Grenzen habe. Wer dieses „Argument“ akzeptiert, unabhängig davon, ob es historisch zutrifft, muss allerdings einen permanenten Weltkrieg für richtig halten, denn historisch „ungerechte“ Grenzen lassen sich vielerorts finden. Das verpflichtet die Menschheit aber doch wohl zu anderen Schlussfolgerungen als zur Kriegsführung! Als zweites Argument wird vom Kreml immer wieder eine im Aufbau begriffene neue multipolare Weltordnung genannt, die die vom Westen selbst verratenen Werte besser bewahre als der absteigende westliche Kontinent. Nicht nur die Taten, sondern auch die Reden belegen also, dass der Kreml aktiv-offensiv und nicht reaktiv-defensiv unterwegs ist.
Dazu passt der kürzlich vorgetragene Verhandlungsvorschlag von Medwedew, die Ukraine sei aufzuteilen in einen zu Russland gehörenden östlichen und einen anderen EU-Staaten anzugliedernden westlichen Teil. Erst ein Verschwinden der Ukraine als Staat sichere den Weltfrieden. Das war ernst gemeint. So gerne man Verhandlungslösungen sehen möchte: dieser Vorschlag ist nichts als eine weitere aggressive Provokation, aber keine Gesprächsbasis. In der Ukraine werden Bandera-Statuen aufgestellt. Schlimm genug. Aber in Russland nimmt die Stalin-Verehrung wieder zu.
Fazit: der Westen führt auf dem Rücken der Ukraine und mit ihr als Handlanger fürs Grobe einen Stellvertreterkrieg gegen Russland als Ergänzung seines jahrelangen Wirtschaftskrieges. Russland führt auf dem Rücken der Ukraine – nach eigenem Bekenntnis – einen Krieg erstens gegen Regierung und Staat Ukraine und zweitens für eine neue antiimperialistische multipolare Welt. Deren Antlitz wird sich mit solchen Methoden allerdings nicht von der alten imperialistischen unipolaren Welt unterscheiden. Braucht eine – gewiss wünschenswerte – neue Weltordnung denn Krieg als Geburtshelfer? Der Weg zum Frieden, zu einer besseren Weltordnung, wird nicht leichter, wenn die Entscheidungsträger auf allen Seiten Krieg als Mittel der Politik für legitim halten. Aber die Projektion des eigenen Friedenswillens auf die eine oder die andere aggressive Seite hilft auch nicht weiter. Auch unsere Regierung und der größte Teil unseres Parlaments ist Teil einer Gewaltmaschinerie und ebenso wenig verhandlungsbereit wie die russische Seite. Das betrifft nicht nur die Taten, sondern auch die zugehörigen Denkweisen und Propagandareden, die auf allen Seiten von Feindbildern durchtränkt sind.
Es mag naiv klingen, ist aber dennoch wahr: Eine bessere Weltordnung beginnt mit dem Frieden oder es wird keine bessere. Als der Psychologe Alfred Adler 1916 nach seinem Einsatz als Arzt im Krieg von Freunden in Wien gefragt wurde, was es Neues gäbe, antwortete er: „Mir scheint, was die Welt zurzeit am meisten braucht, ist Gemeinschaftsgefühl.“ Das ist auch nach einem Jahrhundert noch eine tagesaktuelle Nachricht.
01.07.2023 Digital oder analog?
Es gibt Ignoranten, die am liebsten nicht einmal einen E-Mail Account nutzen. Und es gibt umgekehrt auch Fanatiker, die von einer bargeld- und papierlosen Welt träumen und alles elektrifizieren wollen, vom Verkehr über die Heizung bis zur Kommunikation und der Bildung. Da freut man sich zum Beispiel über den kritischen Kommentar von Klaus Zierer, der das Thema unter verschiedenen Aspekten und auch aus pädagogischer Sicht behandelt.
https://www.nzz.ch/meinung/unheilvolle-turbodigitalisierung-im-schulischen-bereich-ld.1736731
Zunächst weist Zierer auf die fehlende Nachhaltigkeit der überall vorangetriebenen Elektrifizierung hin. Der Strombedarf all der Geräte von den Whiteboards in den Klassenzimmern über Tablets und Beamer bis hin zu den immer leistungsfähigeren Smartphones, die den Kindern immer wieder neu zur Verfügung gestellt werden, wächst immens. Dass beim Bau dieser Geräte seltene Materialien unter menschen- und umweltschädlichen Bedingungen gewonnen werden, wird nahezu ausgeblendet oder schulterzuckend akzeptiert. Dass es nahezu unmöglich ist, den explodierenden Strombedarf einschließlich massiver Infrastrukturinvestitionen „klimaneutral“ zu decken, ebenso. Vor allem „grüne“ und „liberale“ Politiker scheinen sich in ihrer Digitalisierungswut ausnahmsweise einmal einig zu sein. Wieso eigentlich?
Mindestens ebenso wichtig ist die absehbare menschliche Entwicklung – zum Negativen. Zierer beleuchtet hier die Digitalisierung im Bereich Kommunikation und Bildung. Die Lernleistungen gehen seit über zehn Jahren zurück, soziale Auffälligkeiten, psychosoziale Erkrankungen, Spielsucht, Fettleibigkeit, Kurzsichtigkeit und andere Gesundheitsschäden nehmen zu, Lese- und vor allem Schreib- und Rechenkompetenzen nehmen ab. Denn Gedächtnisleistungen hängen auch von ausreichender und unterschiedlicher körperlicher Bewegung ab, sodass sie zu verkümmern drohen, wenn die körperliche Bewegung sich aufs leichte Tippen und Wischen beschränkt. Der zunehmende Abschied von der handwerklichen Erfahrung und der praktischen Auseinandersetzung mit der physischen Welt führt auch zum geistigen Abschied aus der realen Welt. Unterstützt wird dieser Trend durch das Angebot von unendlichen Phantasiewelten im weltweiten Netz.
Ja, es gibt Ausnahmen, zum Teil in gutsituierten Familien, wo man mit den neuen Techniken intelligent umzugehen lernt; aber auch in anderen Kreisen, wo noch menschliches Verständnis lebt, ist man in der Lage, Kinder dosiert mit mit den Datenfluten umgehen zu lassen und ihnen mindestens gleichrangig die Beziehung zu Menschen und auch zu realen Dingen zu lehren. Trotzdem gibt es viel zu viele weniger glückliche Opfer, die kaum noch in der Lage sind, halbwegs anspruchsvolle Berufe auszuüben – weshalb man ja eine neue Form des Kolonialismus einführt: die Einwanderung qualifizierter Arbeitskräfte, die anderswo ausgebildet wurden und dort auch gebraucht werden würden.
Was ist das Ziel der Digitalisierungsanstrengungen? Nur ein wohlgemeinter Plan zur Erleichterung des Lebens? Banales Profitdenken von Medienkonzernen? Ein Programm zu zentralisierender Kontrolle über alle gesellschaftlichen und privaten Vorgänge? Ein bisschen von allem? Wir müssen aufpassen, dass mit rücksichtsloser Digitalisierung nicht die menschliche Natur nachhaltig beschädigt wird. Wir müssen lernen, wie jeder Einzelne von uns technische Entwicklungen zur Verbesserung des menschlichen Lebens, nicht zu seiner Zerstückelung, nutzen kann.
21.06.2023 Eisbrecher für eine schöne neue Welt
Sergej Karaganov, ein prominenter russischer Politologe, hat in einem Interview die mittel- und langfristigen Ziele der „militärischen Spezialoperation“ des Kremls in der Ukraine erklärt. So soll die Welt aussehen, für die sich Russland einsetzt – GlobalBridge
Mir ist nicht bekannt, welche offizielle Funktion Karaganov in Russland hat, aber seine Erklärungen passen inhaltlich sehr gut zu dem, was wir aus den Stellungnahmen von Kremlführern kennen. Es geht um die Befreiung der Welt vom westlichen Joch; Russland stehe mit seiner Spezialoperation, die nur ein kleiner Teil im Rahmen der anstehenden Weltveränderungen sei, an der Spitze dieses Kampfes wie ein Eisbrecher gegen das Resteis des neokolonialen Systems westlicher Vorherrschaft. Die Zukunft liege im Osten, was viele Staaten ja zunehmend sähen und praktizierten. Der kleine Teil Ukraine-Operation habe in diesem globalen Transformationsprozess das Ziel einer vollständig entmilitarisierten, am besten aufgeteilten oder jedenfalls prorussischen Ukraine; nur eine völlig andere Ukraine als jetzt würde einen gerechten Frieden sichern. Der Kampf dort habe das Ziel, dass die Menschen menschlich bleiben können.
Gegenüber einer solchen Aussage sind selbst ironische Kommentare fehl am Platz. Da fehlen einfach die Worte. Das ist Machtpropaganda as usual: Krieg als Treibmittel für den Aufbau einer schönen neuen Welt. Die Toten rechts und links am Wegesrand kommen bei Karaganov mit keiner Silbe vor und werden nicht einmal mit einem leider notwendig gewürdigt. Sie sind einfach nicht der Rede wert. Ebenso wenig ist davon die Rede, dass Russland sich gegen eine Bedrohung oder gar gegen einen Angriff wehren müsse. Selbst Putin hat kürzlich bei einem Wirtschaftsforum in Petersburg eine existenzielle Bedrohung Russlands erneut in Abrede gestellt. Denn darum geht es nicht. Nein, es geht um das große Ziel: wir sind auf dem Weg zu einer besseren, einer bunteren, einer menschlicheren Welt; deshalb haben wir Russen uns aufopferungsvoll und sozusagen aus freien Stücken auf diesen beschwerlichen Weg gemacht.
Ich habe dazu eine Frage: Warum muss diese bessere Welt, die gemäß Karaganov aus den Ruinen des untergehenden riesigen Kontinents westlicher Zivilisation sowieso gerade entstehe, mit einer solchen Spezialoperation im Nachbarland beschleunigt werden – wohl nach dem alten Motto des Stärkeren: was sowieso fällt, das soll man kräftig stoßen? Diese Frage wird von Karaganov und seinesgleichen nicht einmal gestellt, geschweige denn, beantwortet. Aber wenn die Vision von einem weltpolitischen Ziel nicht nur von Absichtserklärungen, sondern von den Taten auf dem Weg dorthin geprägt wird, dann reproduziert der Weg zu dieser schönen neuen Welt lediglich die schlechteren Teile der alten.
Historische Vergleiche funktionieren immer nur oberflächlich, aber hier darf man doch einmal an Napoleon denken, der als Erbe einer Revolution für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit diesen weltpolitischen Prozess mit ähnlichen Spezialoperationen beschleunigen wollte. Und es tatsächlich auch getan hat. Aber um welchen Preis? Fallen uns keine besseren Spezialoperationen ein auf dem Weg zu einer menschlicheren Welt? Nein, auch unseren Politikern fällt zur Zeit leider nichts anderes dazu ein als Panzer um Panzer und Kopf um Kopf. Deshalb sind wir alle aufgefordert, uns etwas Besseres zu überlegen, wenn wir es ernst meinen mit einer menschlicheren Welt.
05.06.2023 Demokratie ist Frieden
Die große Mehrheit der Menschen lebt friedlich und kooperativ. Man sorgt sich um sein eigenes Leben und das seiner Nächsten, seiner Familie, und hat in der Regel kein Interesse daran, Nachbarn und Kollegen zum Teufel zu jagen. Gelegentlicher Ärger oder auch mal Gemeinheiten kommen vor, erklären aber nicht den Menschen von Grund auf zu einem Bösewicht, der von morgens bis abends nur gewalttätigen Egoismus praktiziert. Wenn ein solches Menschenbild realistisch wäre, hätte die Menschheit nicht auf 8 Milliarden angewachsen können, sondern wäre längst ausgestorben. Unter „Freund und fremd“ wird dieser Gedanke genauer betrachtet.
Die größeren Gemeinheiten, die über Raubzüge im Innern und nach außen bis hin zur Kriegsführung reichen, werden von Minderheiten praktiziert und veranlasst. Sie füllen die Geschichtsbücher während der konstruktive, aber unspektakuläre Alltag eher im Dunkeln bleibt. Doch die Aggressionen der machthungrigen Minderheiten füllen leider nicht nur die Geschichtsbücher, sondern belasten allenthalben das Alltagsleben der Mehrheit. Schon Michel de Montaigne wusste, dass nicht die Armut, sondern der Reichtum die Habsucht gebiert; daher lässt sich die Habsucht – und damit Raubzüge und Kriege – logischerweise dadurch vermeiden, dass ein Übermaß an Reichtum, konzentriert in den Händen weniger Bandenmitglieder, vermieden wird.
Der Leser darf sich die Bandenmitglieder gerne als solche vorstellen, die auf den ersten Blick nicht im kriminellen Milieu anzutreffen sind, sondern an den Schalthebeln von großen Wirtschaftseinheiten, in Think tanks und in politischen Ämtern. Das ist kein Argument gegen große Wirtschaftseinheiten oder politische Ämter. Sondern eines für die Notwendigkeit, damit einhergehende Versuchungen zu unterbinden. Wie das geht? Das ist die Sisyphos-Aufgabe der Menschheit seit sie an demokratischen Verkehrsregeln arbeitet. Es ist nicht nur eine organisatorische Aufgabe, das auch, sondern vor allem eine mentale, eine intellektuell-gefühlsmäßige: Es geht darum, die den Menschen immer und überall selbstverständlichen kooperativen Umgangsformen auch von den potenziell räuberischen Minderheiten zu verlangen, die in einflussreichen Positionen sitzen – durch wirksame Gesetze und durch persönlichen Einsatz.
Wenn Demokratie darin besteht, das gesellschaftliche Leben nach dem Willen der Mehrheit zu gestalten und wenn die Mehrheit in ihrem Alltag mit unspektakulärer Kooperation vertraut ist und nur so leben kann, dann muss dieser Mehrheitswille auch zu einem Mindestmaß an sozialer Gerechtigkeit und zu friedlichem Umgang im öffentlichen und internationalen Leben führen. Umgekehrt: Wo soziale Ungleichheit und Kriegsbereitschaft wachsen, muss man das Funktionieren von Demokratie in Frage stellen und die kooperative Praxis als alternativlose Aufgabe nicht nur ins Bewusstsein, das auch, sondern in die Realität zurückholen.
29.05.2023 Bürger-Räte-Republik?
Seit weinigen Jahren forcieren bestimmte politische Kräfte „Bürgerräte“ als neues Demokratieformat. Angeregt und ermutigt wurde das durch eine Kampagne in Irland, mit der dort die gleichgeschlechtliche Ehe und die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs durchgesetzt wurde. Die Themen, die seitdem in verschiedenen EU-Ländern lanciert werden, befassen sich ebenfalls mit „Gendergerechtigkeit“ und vor allem „Klimaschutz“.
Die Bürgerrat-Kampagne wird unter dem Button genauer betrachtet; hier nur so viel: Angeblich repräsentativ werden aus öffentlichen Melderegistern 160 Bürger ausgewählt und zu einem mehrtägigen Treffen zu einem vorgegebenen Thema eingeladen. Unter Mithilfe von beigestellten Experten erarbeiten sie Empfehlungen, die die Politik bitte beachten möge. Manche Aktivisten fordern bereits „Gesellschaftsräte“ zum Thema Klimaschutz, die verbindliche Entscheidungen erarbeiten sollen, welche vom zuständigen Parlament (Bund, Land oder Gemeinde) umzusetzen wären. Bezahlt werden diese millionenschweren Aktionen von interessierten Stiftungen, vom Verein Mehr Demokratie e.V. und unter wohlwollender Mithilfe von gewählten Volksvertretungen bis hin zum Bundestag.
Die Sprecherin von Mehr Demokratie e.V., Claudine Nierth, wurde von der Zeitschrift Cicero zum Thema Direkte Demokratie und Bürgerräte interviewt.
Sie betont zuerst die Notwendigkeit von Volksabstimmungen, die auch unser Grundgesetz – auf Bundesebene bisher vergeblich – vorsieht und wofür der Verein, für den Frau Nierth spricht, tatsächlich seit 30 Jahren gekämpft hat. Im weiteren Verlauf des Interviews wechselt das Thema über zu den Bürgerräten, für die der Verein seit wenigen Jahren eintritt und die er auch mit Hilfe des Deutschen Bundestages in zunehmendem Maß organisiert und finanziert. Dieser Themenwechsel im Interview entspricht ziemlich genau dem Themenwechsel, den der Verein in seiner praktischen Arbeit vornimmt. Frau Nierth plädiert für das Format Bürgerrat als einer wichtigen Ergänzung für die demokratische Meinungsbildung und wünscht sich dafür eine intensivere Praxis und eine größere Verbindlichkeit. Der Interviewer weist mit kritischen Fragen darauf hin, dass die Bürgerräte immer bestimmte Themen vorgegeben bekommen (Klimaschutz, Gendergerechtigkeit, Ernährungsvorschriften) und dass zu diesen Themen auch mit der Auswahl von Experten das Ergebnis gesteuert werde.
Als überzeugter Demokrat kann man diese kritischen Fragen zwar begrüßen, darf sie aber auch getrost als zu harmlos bezeichnen. Angemessen wäre es, diese Bewegung als das zu charakterisieren, was sie ist: eine politische Kampagne, die mit demokratischem Anschein und Unterstützung von gleichgesinnten Mandatsträgern bis in höchste Ebenen, aber an demokratischen Institutionen vorbei, bestimmte zeitgeistige Themen durchsetzen will. Das Engagement für eine echte Institutionalisierung, Stärkung und Nutzung direktdemokratischer Verfahren wird praktisch immer weiter auf ein Abstellgleis geschoben. Die Aktivisten haben wohl erkannt, dass sie ihre eigenen politischen Ziele besser durchsetzen können, wenn sie es nur mit kleinen ausgewählten Gruppen zu tun haben statt mit einem unberechenbaren Volk. Geht es also um „Mehr Demokratie“ oder um mehr Effektivität für die eigenen Ziele von Interessengruppen?
27.05.2023 Was verhandeln?
Die Forderungen nach Verhandlungen statt Waffenlieferungen im Ukrainekrieg sind gut gemeint und aller Ehren wert. Aber wer soll auf welcher Basis was verhandeln?
Selenski weist entsprechende Empfehlungen sogar des Papstes zurück, solange nicht das ganze ukrainische Staatsgebiet inkl. Krim zurückerobert ist. Putin macht nicht nur die Zugehörigkeit von Krim und Donbas zu Russland zur Vorbedingung von Verhandlungen – sondern er lässt sich aktuell dabei filmen wie er eine Karte aus dem 17. Jahrhundert studiert, auf der es die Ukraine als eigenen Staat nicht gibt. Man könnte das für einen schlechten Witz halten – wenn er damit nicht seine Reden vor und während des Krieges inhaltlich in Erinnerung rufen würde und wenn sein Vertrauter und Expräsident Medwedew nicht gleichzeitig Vorschläge für eine „Friedensordnung“ machen würde, und zwar:
Die Ostukraine gehört sowieso zu Russland, die Westukraine wird verschiedenen EU-Staaten zugeschlagen und der zentrale Bereich darf darüber abstimmen, dass er auch zu Russland gehört. Nur bei einem solchen Szenario seien weitere Kriegshandlungen ggf. bis zum Weltkrieg vermeidbar. Kurz: Frieden mit Russland nur unter der Voraussetzung, dass es keinen Staat Ukraine gibt. Das ist keine bösartige Unterstellung, sondern die klar und wiederholt ausgesprochene Zielsetzung der Kremlführung.
Was soll ein denkender und fühlender Mensch sich da wünschen, wenn zwei bewaffnete und kompromisslose Mächte beide einen Staat für sich beanspruchen, der Mitglied der UNO ist? Es besteht kein Zweifel, wer Angreifer und wer Verteidiger ist. Aber was bleibt übrig an Verteidigungswertem? Wünschen kann man sich da wohl nur noch, dass wenigstens alle Waffen ihren Dienst verweigern, wenn die „verantwortlichen“ Führer auf allen Seiten sich weigern, etwas anderes als Waffen sprechen zu lassen. Wer denken und fühlen kann, dem bleibt mal wieder nur die Utopie.
05.05.2023 Zauberlehrlinge
Die künstliche Intelligenz ist in aller Munde. Schon heute können nicht nur Lehrer an Schulen nicht mehr unterscheiden, ob ein Text von einem Schüler oder einer Maschine verfasst wurde, sondern auch Professoren an Hochschulen unterscheiden kaum noch, ob eine Seminar- oder Bachelorarbeit von einem Menschen oder von einem mit ein paar Stichworten gefütterten Computerprogramm verfasst wurde. Dichtung und Wahrheit verschmelzen untrennbar miteinander – aber nicht nur im Kopf eines Künstlers, sondern außerhalb aller menschlichen Köpfe. Maschinen präsentieren uns virtuelle Welten, die über das hinausgehen können, was wir schon lange als gezielte Propaganda gewöhnt sind. Es geht viel weiter. Die Neue Zürcher Zeitung berichtet von einem „godfather“ der KI-Entwicklung, Geoffrey Hinton, der nun die Firma google verlassen hat, auch um über die Gefahren der von ihm maßgeblich mitentwickelten Technik zu warnen.
Er findet es vorstellbar, dass künstliche Intelligenz nicht nur in der Lage ist, selbst einen Computer-Code zu entwickeln, sondern diesen auch in Eigenregie anzuwenden. Das kann sich zum Beispiel auch auf autonome Waffensysteme beziehen, sprich: ohne menschliches Eingreifen könnte eine künstliche Intelligenz einen Waffengang aktivieren… Hinton hat selbst neuronale Netzwerke mitentwickelt, die zu einem „Deep Learning“ führen, das heißt zu der Möglichkeit, dass neuronale Netzwerke mit Hilfe von Algorithmen und großen Datensätzen eigenständig denken lernen. Bei der Geschwindigkeit heutiger Rechner, Datenmengen zu verarbeiten, ist dieses Denken mit all seinen Verknüpfungen und Assoziationsmöglichkeiten, dem menschlichen Gehirn inzwischen überlegen.
Welche Algorithmen, welche Datensätze werden solchen Netzwerken zur Verfügung gestellt? Oder können sie das bald selbst entscheiden? Auf Basis eines welchen „Moral-Algorithmus´“? Wer kontrolliert diese Systeme noch, wenn sie sich in denselben Datenwolken bewegen wie wir Bürger und wie unsere politischen Entscheidungsträger? Niemand wird mehr unterscheiden können, welche von den Computern verbreiteten Informationen einen Realitätsbezug haben oder fiktionale Welten präsentieren. Das wird nicht nur unsere eigenen menschlichen Entscheidungen auf fatale Weise beeinflussen und in die Irre führen, sondern künstliche Systeme selbst werden Entscheidungen treffen können, die unser reales Leben beeinflussen.
Ein konsequenteres Ende der menschlichen Freiheit ist kaum denkbar. Und ein Zaubermeister, der das mit seinem Spruch wieder zur Ordnung ruft, ist nicht in Sicht.
27.04.2023 Die Waffen nieder!
Es war einmal, da empörten wir uns über die vom Westen geführten Kriege. Da es auch innenpolitisch ausreichend Gründe zu Protesten gab, war unsere Orientierung klar: wir sind Opposition. Die Ungerechtigkeiten im Osten haben den einen oder anderen zwar auch interessiert, aber der Osten war zumindest tendenziell schwächer und weniger expansiv; das machte ihn irgendwie sympathischer. Und er berief sich ja auf Stammväter, auf die viele von uns sich damals auch beriefen. Das hat schon damals viele von uns dazu verleitet, mit zweierlei Maß zu messen, eine Haltung, die unter dem Stichwort Nationalismus genauer betrachtet wird.
Aber es hat sich etwas geändert. Teile der einst linken und überwiegend friedfertigen Opposition haben kurz vor der Jahrtausendwende Regierungsverantwortung übernommen. Seitdem sind für viele, die ihr politisches Hemd nicht wechseln wollten, die Aggressionen des Westens zu einem Kampf für das Gute geworden. Krieg als Mittel der Politik ist auch für sie wieder vorstellbar, wenn nicht sogar notwendig, natürlich mit einem wohlfeilen „leider“ versehen.
Andere, die diese Wendung nicht mitgemacht haben und weiter unsere Seite als die aggressive kritisieren, haben inzwischen ebenfalls – wenn nicht schon immer – Verständnis für Krieg als Mittel der Politik. Allerdings sind sie ihrer Oppositionshaltung gegen unsere Seite treu geblieben und pflegen weiterhin Sympathien für die andere Seite. Der russische Krieg in der Ukraine wird von ihnen auch nach 14 Monaten, einer halben Million Toten, unzähligen Verwundeten, Geflüchteten und anderen Zerstörungen als ein – natürlich leider – notwendiger Verteidigungskrieg Russlands (!) deklariert, bei dem doch immerhin die Zivilbevölkerung geschont werde… Wer die Kremlpolitik kritisiert wird der Russophobie verdächtigt, ungefähr so wie jemand des Antisemitismus verdächtigt wird, der die Politik Israels kritisiert.
Während wir uns also früher über- damals illegale! – Waffenlieferungen in Krisen – geschweige denn in Kriegsgebiete empörten, empören sich die einen heute, wenn man zu wenig Waffen nach Kiew entsendet; und die anderen, wenn man den russischen Angriff auch nur beim Namen nennt. Sie alle meinen wohl, man müsste heute realistisch sein und sich globalstrategisch positionieren angesichts des westlichen Abstiegs und des asiatischen Aufstiegs. Die einen wollen mit allen Mitteln den „Westen“, also die extrem nationalistische und korrupte Ukraine verteidigen, die anderen wollen lieber den asiatischen Aufstieg flankieren und deuten diesen Krieg als antiimperialistischen Kampf für einen gerechteren Frieden. Für beide Seiten ist es klar, dass man dabei über manch Unerfreuliches hinwegsehen müsse. Muss man das? Was sagen die Betroffenen dazu, von denen die meisten nicht gefragt wurden?
Es sind wenige geworden, die ungeachtet der großen globalstrategischen Bewegungen für Niemanden Verständnis haben, der gewalttätige machtpolitische Entscheidungen über die Köpfe von Betroffenen hinweg fällt. Es sind wenige, die an der – meinetwegen utopischen – Idee eines friedlichen und menschengerechten Zusammenlebens festhalten; und zwar nicht erst nach einem dafür angeblich mal wieder notwendigen Krieg, sondern unbedingt vorher und statt dessen. Ohne Stimmen, die dieses aus vollem Herzen in alle Richtungen fordern, wird es nie ein Ende der Gewalt und auch keine bessere Welt geben.
20.04.2023 Wem gehört Taiwan?
Die Insel Taiwan ist seit der letzten Eiszeit besiedelt; damals bestand aufgrund des niedrigen Meeresspiegels eine Landbrücke zum Festland. Die Insel gilt als ein Hauptausgangspunkt der Menschen, die in den nachfolgenden Jahrtausenden die Inselwelt des Pazifiks besiedelt haben. Reste der Urbevölkerung sprechen heute noch Sprachen, die mit den polynesischen Sprachen verwandt sind. Immer wieder gab es zwar in historischer Zeit Einwanderungen vom Festland aus, aber die Kultur der Insel entwickelte sich zu etwas Eigenständigem.
Erst als die Niederländer im 17. Jahrhundert den Süden der Insel besetzten, geriet diese direkter in den Einflussbereich auch der chinesischen Dynastien und wurde vor allem aus militärischen Gründen von dort aus vereinnahmt. Es folgten drei Jahrhunderte chinesischer Besatzung einschließlich einer Besiedlungswelle vom Festland aus. Nach einem chinesisch-japanischen Krieg Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Insel von 1895 -1945 japanisch besetzt. Das ging zum Teil mit blutiger Unterdrückung der taiwanesischen Bevölkerung, aber auch mit einem gewissen wirtschaftlichen Aufschwung einher.
Der Bürgerkrieg auf dem Festland führte von 1945 – 1949 dazu, dass die unterlegenen Truppen von Tschiang Kai-schek nach Taiwan flüchteten und dort die politische Macht übernahmen – zum Teil mit Gewalt gegenüber der einheimischen Opposition. Diese „Republik China“ versteht sich als Nachfolger der von Sun Yat-sen 1912 ausgerufenen bürgerlichen Republik, die damals das chinesische Kaiserreich beendet hatte. Die Machtübernahme der Kommunisten auf dem Festland 1949 gilt in dieser Sicht als unrechtmäßige Usurpation. Bis zum Tod Tschiang Kai-scheks 1975 handelte es sich auf Taiwan um eine Ein-Parteien-Herrschaft, die danach schrittweise liberalisiert wurde. International war im Rahmen des Kalten Krieges nur diese Republik (Insel Taiwan) als Vertretung Chinas anerkannt und hatte einen Sitz in der UNO, die kommunistische Volksrepublik (das ganze Festland) jedoch nicht. Dass die politische Führung in Taiwan nicht viel demokratischer regierte als die in Peking, interessierte dabei kaum: schließlich waren es keine Kommunisten…
Das änderte sich 1971 als die USA (Nixon und Kissinger) aus globalpolitischen Gründen mit dem Diktator Mao Tse-tung und seiner aufstrebenden Volksrepublik offizielle Kontakte aufnahmen und deshalb die Republik (Taiwan) fallen lassen mussten. Seitdem ist Peking, nicht mehr Taiwan, in der UNO vertreten. Taiwan wird heute nur noch von wenigen Kleinstaaten, vor allem aus dem pazifischen Raum, diplomatisch anerkannt. Politisch ist es einmal mehr Opfer ausländischer Großmachtpolitik geworden.
Trotz quantitativ umfassender Besiedlung durch Chinesen in den letzten Jahrhunderten hat Taiwan eine eigene Kultur- und Politik-Geschichte. Peking beruft sich heute darauf, dass seine „Ein-China-Politik“ international anerkannt sei, die Insel also zur Volksrepublik gehöre. Das mag man so sehen, wenn man Großmachtpolitik, sei es von Peking, sei es von Washington D.C., sei es aktuell von Paris höherstellt als demokratische Prozesse. Aber wie wäre es, wenn man die Bevölkerung von Taiwan einmal nach ihrem eigenen politischen Willen hinsichtlich ihrer Souveränität befragen würde?
14.04.2023 Von der Banalität des Tiefen Staates
Seit einiger Zeit treten politische Aufklärer mit dem Argument auf, unsere Demokratie verschwinde zunehmend zugunsten eines Tiefen Staates, dessen demokratische Fassade die dahinter liegende Diktatur finanzmächtiger Oligarchen verberge. In dieser Sichtweise treffen sich manche ideologisch Rechte wie Linke zu einer Quer- (nicht queer-) Front – während andere Rechte oder vor allem Linke sich umso entschiedener vom Gegenüber als falschem Aufklärer abgrenzen. Sie sind sich aber weitgehend einig in der Ansicht, dass es eine ebenso unsichtbare wie bestimmende Macht gäbe, die ein klares und stringentes Ziel verfolge, vorbei am Volkswillen oder anderen guten Absichten.
Liest man noch einmal beim „Erfinder“ des Begriffes Tiefer Staat nach, bei Mike Lofgren, einem Kenner des Innenlebens der politischen Kultur der USA, dann entsteht ein anderes Bild (zitiert aus Mies, Wernicke: Fassadendemokratie und Tiefer Staat, Wien 2017):
„Meine These ist keine Verschwörungstheorie, das möchte ich betonen. Es ist viel schwieriger, die ganze Gewöhnlichkeit des Tiefen Staates zu beschreiben. Er ist die Vektorsumme aller kleinkarierten bürokratischen Agenden aller Behörden, von Großkonzernen und Think Tanks, die alle wie eine Ameisenkolonne marschieren, um ihren Vorteil zu maximieren. Der Tiefe Staat ist ein Hybrid aus Max Webers eisernem Käfig der Bürokratie, in dem die bürokratische Routine stereotypes Verhalten menschlicher Akteure verursacht, und Robert Musils ehernem Gesetz der Oligarchie, wonach demokratische Institutionen schließlich eine permanente Führungsschicht mit Top-down-Kontrolle und geringer Verantwortlichkeit entwickeln. … Wie es der amerikanische Schriftsteller Upton Sinclair feststellte: Es ist schwierig, einen Mann dazu zu bringen, etwas zu verstehen, wenn sein Gehalt davon abhängt, es nicht zu verstehen.“… „Noch ein Wort zur US-Präsidentschaft: Auch wenn manche meinen, es handle sich um eine Wahl-Monarchie oder Quasi-Diktatur, nichts davon trifft zu. Der Präsident übt erhebliche Macht aus. Aber: Im Tiefen Staat ist er Primus inter Pares und kein ungebundener Autokrat. … Zu den Schlüsselelementen von Konzern-Amerika gehören der militärisch-industrielle Komplex, Wall Street und Silicon Valley. … Washington ist der wichtigste Knoten des Tiefen Staates, aber es ist nicht der einzige. … Es gibt auch Hilfsorganisationen des Tiefen Staates: Die Steuervermeidungs- und Pseudo-Wissenschafts-Stiftungen…“ Und so weiter. Alle diese Einflüsse verfolgen ihre eigenen Ziele.
In diesem Sinn sitzt im Zentrum des Tiefen Staates nicht ein Gott, der die Dinge nach seinem unumstößlichen Willen gestaltet, sondern es gibt ein Netzwerk von Beziehungen, das von niemandem maßgeblich beherrschbar ist, weder von Bill Gates oder Baron Rothschild noch von demokratischen Wahlen oder dem US-Präsidenten. Die Vektorsumme, die aus diesem Handlungsgeflecht entsteht, ist in ihrer realen Form so von niemandem geplant oder gewollt. Was heißt das, wenn man Demokratie dennoch nicht aufgeben will? Man muss Menschen dazu bringen, etwas zu verstehen, auch wenn es für die eigene Bequemlichkeit besser wäre, nicht zu verstehen. Und man muss sie dazu bringen, aus diesem Verständnis Teil des Handlungsgeflechtes werden zu wollen, ein möglichst effektives. Dazu können demokratische Institutionen hilfreich sein, mehr als es in Diktaturen der Fall ist, aber vor allem ist persönliche Aktivität gefragt, von jedem Einzelnen, sei es allein, sei es als Teil einer Gruppe. Damit verlassen wir die politische Ebene und sind bei der Aufgabe der persönlichen Charakterbildung, also bei der Erziehung. Einschließlich einer guten Bildung. Demokratie ist Stärkung der Persönlichkeit.
13.04.2023 Wahlrechtsreform – zum Dritten
Der Vorschlag, die Personen-Überhangmandate bei der Bundestagswahl nur einmal bundesweit und nicht 16mal landesweit auszugleichen (siehe unten 18.03.2023), führt zu partei-gerechten und personenbezogenen Ergebnissen sowie zu einem deutlich kleineren Bundestag. Diese konsequente Vernachlässigung von Länderinteressen bei der Bundestagsbildung muss auf der anderen Seite eine größere Konsequenz für die Landesvertretungen erzeugen. Bislang ist die Länderkammer auf Bundesebene (Bundesrat) nur ein Ausschuss der Länderregierungen, halbherzig so vertreten, dass weder die Bundesländer noch die einzelnen Bürger gleichstark repräsentiert sind. In den konsequenter gestalteten föderalen Staaten USA und später Schweiz sind die Einzelstaaten, bzw. Kantone gleichstark durch direkt gewählte Personen vertreten, unabhängig von der Einwohnerzahl der Einzelstaaten. Diese waren damals (USA 1788, Schweiz 1848) historisch älter als der zunächst nur als schwache Klammer darüber gebildete Bund.
Auch in Deutschland sind die Bundesländer meist etwas älter als der Bund und als selbständige Staaten mit Verfassung, Legislative, Exekutive, Judikative organisiert. Der Zuschnitt dieser Staaten geschah zwar nach dem Zweiten Weltkrieg etwas willkürlich durch die alliierten Auslandsmächte; dennoch ist darin eine lange föderale Geschichte auf deutschem Boden abgebildet, die später mehrfach durch Volksabstimmungen über den Länderzuschnitt bestätigt oder korrigiert wurde.
Das spricht dafür, dass die Ländervertretung auf Bundesebene besser dargestellt werden muss als es bis heute tatsächlich der Fall ist. Der Bundesrat ist leider zu einem Ersatz-Korrektiv des Bundestages verkommen, der gelegentlich dort vorhandene Parteiproporze durch hier vorhandene Parteiproporze konterkariert. Nicht viel mehr und nicht viel weniger. Eine zweite Spielwiese für die Parteien, statt eine echte Ländervertretung. Wie diese aussehen könnte, wird unter Kernthemen / Föderalismus behandelt. Hier nur so viel:
Der Bundesrat sollte direkt gewählt werden als wäre er ein echtes Parlament – das soll er nämlich sein! Das Wahlsystem sollte so gestaltet sein, dass Partei-Einflüsse möglichst zurückgedrängt sind. Eine Persönlichkeitswahl müsste so ausgestaltet sein, dass sie möglichst wenig von Parteien dominiert werden kann. Zum Beispiel könnte jeder Bürger drei oder vier Stimmen haben, die er auf verschiedene Personen oder auch auf nur eine verteilen kann. Gewählt sind dann jeweils die drei bis sechs stärksten Kandidaten, falls es bei der jetzt bestehenden Gewichtung der Länder bleibt. Natürlich kann auch eine andere Gewichtung der Länder überlegt werden, die sich mehr an der Einwohnerzahl orientiert oder alle Länder gleich gewichtet. Wichtig ist, dass eine Direktwahl von Personen eine größere Nähe und Verantwortlichkeit zwischen Bürgern und Entscheidungsträgern bewirken kann. Ebenso müsste es möglich sein, dass parteilose Kandidaten antreten und eine adäquate staatliche Unterstützung dafür erhalten.
In diesem Bundesrat würden dann tatsächlich vom Bürger gewählte Landesvertreter sitzen, denen ihr Land hoffentlich nähersteht als ggf. eine Parteizugehörigkeit. Denn für die Landesinteressen auf Bundesebene sind sie ihren Wählern direkt verantwortlich und müssen sich entsprechend beweisen.
Zum besseren Föderalismus gehört auch, dass die im Grundgesetz bestimmte „konkurrierende Gesetzgebung“ zwischen Land und Bund wieder vermehrt in die Landesparlamente zurückgeholt wird. Demokratie lebt auf mit der Stärkung dezentraler Souveränitäten und die Beteiligung der Bürger daran lebt auf, wenn die Dezentralität institutionell gut organisiert ist. Oder in Anlehnung an ein Bibel-Zitat des Apostels Paulus: Gebt dem Bund, was des Bundes ist und dem Land, was des Landes ist.
18.03.2023 Wahlrechtsreform – nachher
Sie haben es getan. Die Regierungskoalition setzt eine Reform durch, die unser Wahlsystem zu einer Verhältniswahl mit nachgeordneter persönlicher Ergänzung macht. Es lebe die Parteienherrschaft! Nicht jeder persönliche Wahlsieger eines Wahlkreises muss schließlich Abgeordneter werden, oder? Warum so zögerlich, liebe Regierungskoalition? Warum nicht gleich die Persönlichkeitswahl ganz abschaffen? Schließlich müssen ja nicht die Bürger entscheiden, welcher Person sie das Gewissen zutrauen, das ganze Volk zu vertreten, das können nur die Parteien! Was macht es schon, wenn viele Wahlkreise einen persönlich gewählten Abgeordneten haben, andere aber nicht? Die haben dann eben Pech gehabt, na und?
Bleibt nur zu hoffen, dass das Bundesverfassungsgericht erkennt, dass die grundgesetzlich vorgeschriebene Gleichheit der Wahl damit nicht mehr gegeben ist. Schade, dass die Damen und Herren Abgeordneten meinen Beitrag vom 25.02.23 oder den Reformvorschlag unter Genauer betrachtet nicht gelesen haben… Sie hätten sich und uns dann viel unnötigen Ärger erspart.
16.03.2023 Links? Rechts? Oder sachorientiert?
Es war einmal, die Älteren erinnern sich, da wusste man, was links oder rechts politisch bedeutet. Links war man für die sozial Schwachen, teils verbunden mit pseudowissenschaftshistorischen Theorien, man war tendenziell zwar antimilitaristisch, aber nur bedingt pazifistisch (das waren konsequent nur manche religiösen Gemeinschaften), tendenziell antinational-internationalistisch; viele glaubten, dass die Gleichheit der Menschen, tendenziell noch vor der individuellen Freiheit, das Ziel politischer Arbeit sein müsse. Rechts war man vor allem nationalbewusst bis hin zu tendenziellem Rassismus; Armut galt vor allem als von der Dummheit oder Faulheit der Betroffenen verursacht, weshalb man sich gegen alles Bedrohliche oder Minderwertige im Zweifel mit Gewalt wehren müsse. Denn natürlich seien die Menschen nicht gleich und selbst größere soziale Unterschiede auf der Basis individueller Freiheit deshalb berechtigt.
Wo stehen wir heute in diesem Spektrum? In den Wortmeldungen der Parteien oder politisch aktiver Bürger kann man ähnliche Aussagen in verschiedenen Varianten manchmal noch erkennen. Und in den Taten? Eine sozialdemokratische Regierung hat Anfang des Jahrtausends einen Sozialabbau vorangetrieben, der anderen kapitalistischen EU-Staaten als vorbildlich galt. Zusammen mit einer damals noch für links gehaltenen Grünen Partei wurde wieder Angriffskrieg von deutschem Boden aus geführt. Inzwischen empört sich erneut eine rot-grüne Regierung über jeden, der keine Waffen in Kriegsgebiete liefern will. „Klimaschutz“-Ziele, was auch mal eine eher linke Forderung war, obwohl die Quelle eine andere ist, werden aus globalpolitischen und militärischen Interessen faktisch aufs Abstellgleis geschoben. Eine sich dagegen noch als links verstehende Minderheit, die zumindest deutsche Waffenlieferungen ablehnt, ist zunehmend damit beschäftigt, sich mindestens so sehr von rechten Kriegsgegnern wie von linken Kriegstreibern abzugrenzen.
Auf einmal hört man Stimmen aus dem Militär (a.D.) und vom rechten Rand, die sich deutlich für Friedenspolitik aussprechen und deren Anhängerschaft engagiert für soziale Rechte von Benachteiligten eintritt. Soziale Besitzstände zu wahren ist (auch) zu einem „rechten“ Anliegen geworden, während die Linke mit dem „internationalistischen“ Migrationsthema um Verständnis für soziale Opfer wirbt. Die Idee der Gleichheit der Menschen wird von links mit einer Gender-Ideologie zerstört, deren Haupteffekt eine Spaltung in diverse Gruppen ist, wodurch einem tendenziell rassistischen Antirassismus der Weg geebnet wird. United we stand, divided we fall – das war einmal. Aber nicht nur bei sozialen und militärischen Themen laufen Linke und Rechte „Gefahr“, in einen Gleichschritt, wenn nicht in einen umgekehrten Gegenschritt zu kommen; auch bei der Ablehnung unserer demokratischen Institutionen ist Ähnliches schon zu beobachten.
Wäre es nicht besser, wir würden diese abstrakten Orientierungsmarken aus dem 19. Jahrhundert einfach mal vergessen und uns im sachlichen Gespräch um die anstehenden Aufgaben kümmern?
25.02.2023 Wahlrechtsreform – vorher
Der Verein Mehr Demokratie e.V. hat 2012 beim Bundesverfassungsgericht gegen gewisse Ungerechtigkeiten unseres Wahlsystems geklagt und erreicht, dass das Wahlgesetz angepasst werden muss. Die Politiker verbinden diese Aufgabe zugleich mit der Absicht, dass die Zahl der Abgeordneten, die durch Ausgleichs- und Überhangmandate immer größer geworden ist, zu reduzieren. Das ist auch gut so.
Im ersten Schritt hat man die Zahl der Wahlkreise etwas verringert und beschlossen, nicht alle Überhangmandate auszugleichen. Das ist nicht gut so, sondern schwammig willkürlich und wird nach allgemeiner Einschätzung wenig bewirken. Im aktuellen Regierungsentwurf sieht man vor, Personenstimmen (Erststimmen) zu streichen, wenn sie zu stark von den Parteistimmen (Zweitstimmen) abweichen. Das ist noch weniger gut, weil damit die Personenwahl abgewertet und die Parteienherrschaft zementiert wird; nicht jeder Wahlkreis würde dann einen persönlich gewählten Vertreter haben!
Unser Wahlsystem basiert auf der guten Idee, in jedem Wahlkreis einen persönlich zu wählenden Abgeordneten in den Bundestag zu schicken und durch eine ergänzende Verhältniswahl die Ungerechtigkeit eines reinen Systems „the winner takes it all“ zu vermeiden. Diese Idee lässt sich mit einer Begrenzung der Abgeordneten-Anzahl dann vereinbaren, wenn man wie folgt vorgeht: Alle Erststimmensieger in jedem Wahlkreis sind gewählt. Um das Verhältnis gemäß den Parteistimmen herzustellen, werden nur so viele zusätzliche Abgeordnete in den Bundestag geschickt wie für den Ausgleich der Erststimmen nötig sind. Es wird also nicht für jeden Wahlkreis ein weiterer Abgeordneter bestimmt. Dieser Ausgleich geschieht nicht in jedem Bundesland getrennt, sondern nur einmal auf Bundesebene. Die Parteien müssen also Bundes- (nicht Landes-)listen für den Ausgleich der Erststimmenergebnisse führen. Rein rechnerisch kann es damit – je nach Differenz Erst- /Zweitstimme – sowohl weniger als auch mehr Abgeordnete geben als 2 x die Wahlkreisanzahl. Bei einer nur bundesweiten (nicht landesweiten) Auszählung wird es aber einen Ausgleich in Richtung weniger Abgeordnete als 2 x 299 geben.
Dass dabei nicht jeder Wahlkreis auch mit einer Zweitstimme „repräsentiert “ wird, ist kein Problem, weil die Zweitstimme sich ja nicht auf eine Person, sondern auf eine Partei bezieht, sodass kein persönlicher Anspruch besteht. Und eine bundesweite (nicht landesweite) Parteilistenführung ist deswegen gerecht, weil es sich um eine Bundestagswahl handelt und jeder Abgeordnete das ganze deutsche Volk und nicht sein „Landesvolk“ auf der Bundesebene zu vertreten hat. (Für letzteres gibt es den Bundesrat.) Wie die Landesparteien sich auf eine Bundesliste einigen, ist deren Aufgabe; das gilt auch für CDU/CSU. Mit diesem System wird die Persönlichkeitswahl für jeden Wahlkreis gewahrt, das Parteienverhältnis als „Minderheitenschutz“ ebenfalls, und die Zahl der Abgeordneten wird mit hoher Wahrscheinlichkeit deutlich reduziert. Die Persönlichkeitswahl für jeden Wahlkreis muss auch deswegen beibehalten werden, weil damit nicht parteigebundene Personen eine Chance zum Wahlsieg behalten.
Diese Idee wird unter Direktere Demokratie_Reformvorschlag etwas genauer betrachtet.
12.02.2023 Wissen und Meinen und vor- ver- Urteilen
Anlässlich des Ukrainekrieges wird geredet und geschwiegen wie lange nicht mehr. Geredet wird – auf uns ein. Von Politikern und Journalisten, in Zeitungen, Fernsehen und „sozialen“ Medien. Geschwiegen wird – untereinander. Jedenfalls wird selten mit Freunden diskutiert in der Absicht, Unverstandenes zu verstehen, Informationen auszutauschen und sich darüber zu wundern. Vielmehr werden die Informationen aufgenommen, die eine längst gefasste Meinung bestätigen, andere beiseite geschoben oder mit Gegenbeispielen aus anderen Zusammenhängen konfrontiert, um sie zu relativieren. Ich höre zunehmend von verschiedenen Seiten, dass man mit Andersdenkenden oder sogar alten Freunden nicht mehr reden könne. Keiner will wirklich was wissen, weil er ja eh schon weiß, oder zumindest eine Meinung hat – und das darf man ja wohl in einer Demokratie…
Als würde das, was augenblicklich in der Weltpolitik geschieht, dank der gleichzeitig öffentlich zugänglichen Verlautbarungen und einsehbaren Dokumente ausreichend durchschaubar sein. Als wäre die Zeitgeschichte durch das gerade Sichtbare ausreichend erkennbar. Als hätte es in der Geschichtswissenschaft nicht immer schon Überraschungen gegeben, wenn scheinbar Klares durch erst viel später zugängliche Dokumente manchmal ganz andere Färbungen bekommen hätte. Sodass heute selbstverständlich Erscheinendes vielleicht mit ein oder zwei Fragezeichen zu bedienen wäre. Auf allen Seiten.
Aber für die einen ist es klar, dass die Verteidigung der angegriffenen Ukraine notwendig ist und nur mit noch mehr Waffen gelingen kann – egal, was an Verteidigungswertem hinterher noch übrig bleibt. Und für die anderen ist es klar, dass die Bedrohungskulisse durch den Westen Russland keine Wahl gelassen habe, als sich durch präventiven Angriff zu verteidigen, koste es was es wolle. Unter diesen Vor-Urteilen wird jede Information so oder so eingeordnet – eine Geisteshaltung, die unter dem Stichwort Nationalismus genauer betrachtet wird.
Festgefügte Meinungen lassen sich nur schwer durch Wissen heilen. Vor allem dann nicht, wenn eine ethische Basis fehlt, die besagt, dass Krieg niemals Mittel der Politik sein darf. Wenn beide Seiten diese Haltung hätten – und zwar unabhängig von der Haltung des anderen! – gäbe es keinen Krieg. Aber auch im vorliegenden Fall haben beide Seiten diese Haltung nicht. Dass gegen ungerechte Herrschaft auch ziviler Ungehorsam eine Möglichkeit wäre, die zweifellos mehr Mut und Intelligenz, aber sicher weniger Blutzoll fordert, ist den Entscheidungsträgern und ihren Gefolgsleuten auf allen Seiten keine Option. Und wenn das staunende Publikum außerhalb des Kriegsgebietes diese Haltung hätte, würde es den Kriegsakteuren hinter den Kulissen in den Arm fallen statt sich auf die eine oder andere Propagandaseite zu schlagen. Aber wer die Bomben nicht selbst einschlagen hört… Vielen fehlt es offenbar an Phantasie und Vorstellungskraft, die es braucht, um die einfachen Worte der Alten zu verstehen:
Cicero: der ungerechteste Frieden ist immer noch besser als der gerechteste Krieg. Oder noch einfacher Bertha von Suttner: Die Waffen nieder!
28.01.2023 Beliebte Politiker
Wie kommt es eigentlich, dass Habeck und Baerbock laut Umfragen immer noch die beliebtesten Politiker sind? Die rufen (abgesehen von Strack-Zimmermann) am lautesten nach Waffen gegen Russland, obwohl die Mehrheit der Deutschen dagegen ist, die benehmen sich offensichtlich wie blutige Anfänger in ihren Ministerien, tappen ständig in Fettnäpfchen und müssen korrigiert werden…
Interessante Frage. Pazifisten sind sie ja schon seit dem Jugoslawienkrieg nicht mehr, daran ist ihre Wählerschaft gewöhnt. Gewählt und geliebt werden sie dafür wahrscheinlich auch von anderen, die früher die Grünen nicht einmal mit Handschuhen angefasst hätten.
Ja aber dieser Dilettantismus, was ist denn daran attraktiv? Es gibt doch genug andere Kriegsbefürworter.
Vielleicht erscheinen die anderen nicht stramm genug, die Grünen lassen ja nicht den geringsten Zweifel an ihrer Haltung aufkommen. Und für den Dilettantismus werden sie wahrscheinlich von einer anderen Klientel gewählt und geliebt: von denen, die schon lange nichts mehr von der etablierten Politik wissen wollen und die Grünen immer noch für eine nicht etablierte Alternative halten. Mit dem Dilettantismus wird dieses Bild „wir sind nicht das alte Establishment, wir sind zwar nicht perfekt, aber wir sind die Anderen und wir zeigen allen mal, wo´s langgeht“ gefüttert.
Das klingt jetzt so, als würdest Du die Anhängerschaft von Donald Trump beschreiben.
Das hast Du gesagt.
Aber es stimmt ja nicht, Trump wollte ja provozieren, der war kein Dilettant.
Vielleicht weiß Baerbock als oberste Diplomatin (!) ja auch, was sie tut, wenn sie sagt, „Russland muss ruiniert werden … wir führen gegen Russland Krieg“, um dann wieder einen halben Schritt zurückgeholt zu werden, einen halben! Die ist ja nicht blöd. Und ihre teuren Berater auch nicht.
?
11.01.2023 …blowing in the wind
In seinem Alterswerk, dem Buch über 66 Songs, die ihn beeindruckt und beeinflusst haben, formuliert der Literaturnobelpreisträger von 2016 einige kluge Gedanken in seiner typisch flapsigen, aber treffenden Art. Er bezieht sich auf einen Song von Pete Seeger, der wegen seiner kritischen Anspielungen zuerst nirgends gesendet wurde, ein Jahr später, als die politische Wetterlage sich etwas gedreht hatte, dann aber doch. Damals, in den 1960er Jahren, habe es noch eine Öffentlichkeit gegeben, die all das aufmerksam wahrgenommen hat, auch wenn nicht jeden alles interessiert hat. Kriegsgegner und Kriegsbefürworter schalteten damals dieselben Fernsehsendungen ein, weil es gar nicht viele Auswahlmöglichkeiten gab.
„Wir hatten alle ein gemeinsames Grundvokabular. Menschen, die die Beatles in einer Abendsendung sehen wollten, mussten sich auch Flamenco-Tänzer, Komiker in weiten Hosen, Bauchredner und vielleicht sogar eine Szene aus Shakespeare anschauen. Heute ist das Medium so vielschichtig, man muss sich nur eine Sache herauspicken und kann sich ihr ganz ausschließlich auf einem spezialisierten Stream widmen… Anscheinend stopft man Menschen nicht dadurch am besten den Mund, dass man ihnen ihr Forum nimmt – man muss ihnen nur jeweils eine eigene Kanzel verschaffen. Zum Schluss hören sich die meisten nur noch an, was sie sowieso längst wissen, und lesen nur noch das, womit sie längst einverstanden sind. Sie verschlingen einen faden Abklatsch von Vertrautem und werden vielleicht nie entdecken, dass sie ein Faible für Shakespeare oder Flamenco haben. Das ist genauso, wie wenn man einem Achtjährigen die Entscheidung überlässt, was er essen möchte. Er wird nur noch Schokolade zu sich nehmen und irgendwann an Mangelerscheinungen leiden, schlechte Zähne bekommen und fünfhundert Pfund wiegen.“ (Bob Dylan: Die Philosophie des modernen Songs, München 2022, S. 337 f).
Diese Beobachtung über eine einseitig eingeschränkte Wahrnehmung aufgrund vielfacher Auswahlmöglichkeiten kann man auch auf die politische Welt beziehen. Es gibt heute Mainstreams und Antimainstreams, von manchen auch „Echokammern“ genannt, die sich zwar entfernt aufeinander beziehen, aber letztlich einen Verlust an Öffentlichkeit darstellen. Der politisch Andersdenkende wird schon noch wahrgenommen – als Gegner, aber im jeweiligen Publikum kaum als ernstzunehmender Gesprächspartner. Man hat ja seine eigenen Gesprächspartner auf diversen Kanälen. Dieser Verlust ist übrigens nicht nur in einem so genannten Mainstream zu beobachten, sondern auch in Antimainstream-Medien. Viele dieser Follower nehmen Mainstream-Medien nicht mehr selbst, sondern oft nur noch über Anti-Mainstream-Kommentare zur Kenntnis. Und umgekehrt. Nebenbei: als Leser in beiden Quellen fällt mir auf, dass „Mainstream“-Medien tendenziell über eine größere Meinungstoleranz verfügen als die Anti-Mainstream-Portale.
Wir haben es mit einem Paradoxon zu tun: mit einem Verlust von Öffentlichkeit aufgrund so vieler Möglichkeiten zu (halbwegs) öffentlichen Äußerungen. Man könnte auch sagen: die Öffentlichkeit zerfällt dank omnipräsenter Medientechnik zunehmend in private Zirkel und verschwindet als Ort gemeinsamer Auseinandersetzung. Oder in den Worten, die Jean Paul schon vor 200 Jahren sagte: „Bei Gott, alle Welt spricht und niemand kommt zu Wort.“ Ja, auch diese Website hier ist nur eine weitere „eigene Kanzel“, aber ich bemühe mich zumindest, dass für jede/n etwas dabei ist, was ihr / ihm nicht gefällt.
07.01.2023 …mehr Arbeit als man denkt
In der zurückliegenden Silvesternacht gab es mehr als sonst gewalttätige Ausschreitungen nicht nur gegen die Polizei, sondern sogar gegen Feuerwehr und Rettungskräfte. Die überwiegend jüngeren und jugendlichen Täter*Innen kommen aus verschiedenen Milieus, nicht nur aus migrantischen. Das zeigt, dass es eine wachsende Szene von jungen Menschen gibt, die jede staatliche Autorität ablehnen und bei Gelegenheit auch angreifen.
Diese Gewalttätigkeiten werden in unserer Presse zwar abgelehnt und es wird sogar offen ausgesprochen, dass gut die Hälfte der Täter einen Migrationshintergrund hat. Aber wenn man einen breiteren Blickwinkel nimmt, stellt man fest, dass gesetzwidriges Verhalten je nach Anlass mit zweierlei Maß bemessen wird. Wenn „Klimaschützer“ rechtswidrig handeln und manchmal gemeingefährlich gewalttätig werden, auch gegen die Polizei, zögern viele Kommentatoren und sogar politisch Verantwortliche mit ähnlich deutlichen Worten. Vor wenigen Jahren wurde monatelang ein 2 qkm großes Waldstück besetzt, teils sogar mit dem Argument, das Klima und die Artenvielfalt zu retten, obwohl in diesem Waldstückchen – tatsächlich ein menschengemachter Forst! – nach der Dauerbesiedelung durch Klimaschützer in Baumhäusern sicher keine bedrohte Tierart (mehr) dort zuhause war, weil diese sich zu Recht von den Besetzern bedroht fühlen musste. Aber darum ging auch nur propagandistisch am Rande, tatsächlich wollte man entgegen demokratischen Beschlüssen verhindern, dass dort eine letzte Tranche Braunkohle abgebaggert und dann verstromt wird. Dasselbe Ziel – Braunkohleabbau verhindern – haben zur Zeit auch die „Verteidiger“ eines Dorfes in derselben Gegend, ein Dorf, in dem niemand mehr lebt und um das es gar nicht geht. Die Rechtslage ist klar und demokratisch legitimiert, aber für die kleine Minderheit der aktiven Gegner des genehmigten Kohleabbaus wird öffentlich deutlich mehr Verständnis geäußert als für die Gesetzesbrecher in der Silvesternacht. Sogar für die zur Zeit aktiven Fanatiker der „letzten Generation“, die Kunstwerke demolieren oder sich unter Gefährdung der eigenen und der öffentlichen Sicherheit, auf Straßen und Flugbahnen kleben, um den Weltuntergang aufzuhalten, wird nach ein paar mahnenden Worten um Verständnis für deren berechtigtes Anliegen geworben. Das Amtsgericht Freiburg hielt es in einem Urteil vom 21.11.2022 für rechtens, dass eine Straßenblockade über eine Stunde lang den Verkehr aufhielt, weil der Autoverkehr ja CO2 ausstoße. Solche Toleranz für gelegentlichen Unsinn mag man vielleicht seinen heranwachsenden Söhnen gegenüber zeigen, die gestern Abend zu spät nach Hause gekommen sind und ein Bier zu viel getrunken haben…
Aber hier handelt es sich um Erwachsene, die bewusst und organisiert die demokratische Ordnung einschließlich der Rechtsstaatlichkeit nicht anerkennen und sich als diktatorische Besserwisser aufführen. Sie sind sicher (noch) keine reale Gefahr, da ist die Klugheit demokratischer Mehrheiten stärker. Man könnte also auch kopfschüttelnd darüber schmunzeln. Aber es ist ein Problem für die Pflege der demokratischen Kultur. Es ist ein Ausdruck von Missachtung demokratischer Entscheidungen und eine Einübung von minderheitsbasierten Zwangsmaßnahmen, wenn einem mehrheitsbasierte Entscheidungen nicht passen. Dagegen muss in Wort und Tat Stellung bezogen werden, denn es etablieren sich – damit schließt sich der Kreis zur Silvesternacht – Verhaltensweisen, die in einer Demokratie nichts zu suchen haben. Randale von Minderheiten darf nicht zum Mittel politischer Auseinandersetzung werden. Dass auch die politisch Verantwortlichen durch ihr zunehmendes Verständnis für Krieg als Mittel der Politik ein falsches Vorbild in dieselbe Richtung abgeben, steht auf einem anderen Blatt und macht die Sache nicht einfacher.
14.12.2022 Demokratie und Frieden
Welche Kriege der letzten Jahrzehnte, um nur die jüngere Zeit ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu betrachten, waren Verteidigungskriege? Aus wessen Sicht? Korea, Vietnam, Afghanistan, Jugoslawien, Irak, Libyen, Ukraine … um nur einige zu nennen, sind Länder, in denen Krieg geführt wurde, die also in der Verteidigungsposition waren. Angreifer waren die USA und deren westliche Verbündete, die Sowjetunion und zuletzt Russland. In jedem einzelnen Fall haben die Invasoren Gründe dafür genannt, dass sie selbst die Verteidiger seien von etwas oder von jemand. Je nach politischer Weltanschauung haben die einen oder die anderen Menschen hierzulande dafür Verständnis gezeigt.
Aber wie können Kriege außerhalb des eigenen Landes Verteidigungskriege sein? Welches der oben genannten Länder stand im Begriff, die Invasoren anzugreifen? Die einmarschierenden oder bombardierenden Länder waren (mit Ausnahme der Sowjetunion) solche, die sich als Demokratien verstehen. Sollte in Demokratien über so etwas wichtiges wie Kriegsführung in einem anderen Land nicht das Volk abstimmen? Und zwar direkt und konkret zu der Frage, ob Vietnam, Jugoslawien etc. bombardiert werden sollen? Abgesehen davon, dass solche Aktivitäten sowieso inakzeptabel sind: welches Volk würde bei einer freien und geheimen Abstimmung dazu mehrheitlich Ja sagen?
Solche Abstimmungen wären ein Prüfstein für demokratische Verhältnisse, denn was könnte die öffentlichen Angelegenheiten mehr betreffen als die die Frage von Krieg oder Frieden? Gerne führen manche Zeitgenossen die Verführbarkeit und Aggressivität des Volkes gegen ein solches Plebiszit an. Schließlich habe Goebbels lauten Jubel geerntet als er fragte „Wollt ihr den totalen Krieg!?“ Aber wer ist da gefragt worden? Nicht das Volk in geheimer Wahl, sondern ein paar tausend handverlesene Parteigänger, die im Berliner Sportpalast Platz gefunden hatten.
Ich bezweifle, dass selbst in den USA bei freier, gleicher und geheimer Wahl eine Mehrheit für Angriffe in Korea oder Vietnam gestimmt hätte. Ich bezweifle, dass im Donbas die bewaffnete Separation abtrünniger ukrainischer Militärs von einer frei, gleich und geheim befragten Bevölkerung mehrheitlich unterstützt worden wäre. Und so weiter.
Ob unsere Waffen außerhalb der eigenen Landesgrenzen „sprechen“ dürfen, gehört – außer in eng zu definierenden Notwehrsituationen mit dringenden Einsätzen gegen unmittelbar bevorstehenden Angriff – dem Volk zur Entscheidung vorgelegt. Die Welt wäre wesentlich friedlicher, jede Wette, wenn alle Länder das so regeln würden. Aber die bisherigen Entscheidungsträger für Kriegseinsätze im Ausland, also unsere gewählten Volksvertreter, werden solche Abstimmungen absehbar kaum einführen; vielmehr sind sie seit Jahren zunehmend damit beschäftigt, ihrem Volk den Krieg als legitimes Mittel der Politik wieder schmackhaft zu machen. Kritische Stimmen werden zur Zeit nur dann öffentlich goutiert, wenn sie die Auslieferung von Panzern in Kriegsgebiete als zu zögerlich (!) brandmarken. Deshalb haben Demokraten in Zukunft eine wichtige Aufgabe, nämlich diesen Prüfstein für Demokratie entgegen der anschwellenden Kriegsbereitschaft institutionell zu etablieren: Militärische Einsätze im Ausland nur nach einer Volksabstimmung, bei der mehr als 50 % der Wahlberechtigen Ja sagen müssen!
11.11.2022 Konkret statt abstrakt
In jüngeren Jahren orientieren sich viele Menschen gerne an abstrakten Begriffen, wenn sie die Welt verbessern wollen. Wörter wie Nationalstolz oder Sozialismus, Liberalismus oder Klimaneutralität, etc. oder in abstraktester Form links oder rechts, plakatieren zu verschiedenen Zeiten in verschiedenen Ländern verschiedene Leitthemen oder weltanschauliche Richtungen, die das politische Denken vieler Menschen prägen. Solange die Menschen, die ihre Handlungsprioritäten aus solchen Zielsetzungen ableiten, miteinander sprechen und Kompromisse zu anstehenden Aufgaben entwickeln, ist das ein gesunder demokratischer Prozess. Sobald aber ein solches Leitthema das alles bestimmende sein soll, gilt der G.F.W. Hegel zugeschriebene Spruch: „Wer Abstraktionen gegen die Wirklichkeit geltend macht, zerstört diese.“ Dieser Satz ist zwar auch dann wahr, wenn konkurrierende Abstraktionen gegen die Wirklichkeit antreten; aber sofern daraus Kompromisse entstehen, schafft sich die Wirklichkeit dann doch einen gewissen Einspruch.
Diese Beobachtung lässt sich noch etwas weiterführen: Menschen, die allmählich das Stadium der Altersweisheit erreichen, haben zunehmend Probleme mit Abstraktionen als Handlungsleitlinien. Sie sehen den Sinn der Weltverbesserung eher in den konkreten Handlungen, die sich tatsächlich durchführen lassen – wohl wissend, dass damit nicht so viel auf einmal erreicht wird, wie man sich das als junger Mensch von einer abstrakt plakatierten radikalen Umwälzung erhofft hatte. Denn mit wachsender Lebenserfahrung wird dem Menschen nicht nur das Gewicht menschlicher Kulturen im Detail bewusster, sondern auch die vielen abstrakten Zielsetzungen innewohnende Gewalttätigkeit.
Es wäre zu wünschen, dass diese Art von Altersweisheit möglichst früh im Leben eines jeden einsetzen möge. Dann würde unsere Gesellschaft sicher menschengerechter funktionieren. Man könnte sich sogar fragen, wozu dann noch eine politische Ebene notwendig wäre oder welche Aufgabe sie hätte, wenn die Menschen allenthalben freundlich und hilfsbereit miteinander umgingen ohne dabei die großen Fahnen zu schwingen.
Das ist eine rhetorische Frage, denn natürlich gibt es in unserer technisch komplexen und global vernetzten Welt mehr Dinge zu regeln als jeder Einzelne im Rahmen seiner persönlichen Reichweite angemessen zu regeln vermag. Also sind übergeordnete Aktivitäten notwendig. Die Zivilgesellschaft braucht politische Ebenen als Regulativ, als Ort des Meinungsaustauschs und der Entscheidungsfindung und als organisatorische Hilfe, wenn sie sich verantwortungsvoll um die alltäglichen konkreten Aufgaben kümmern will. Die politische Ebene ist in diesem Bild der Zivilgesellschaft nachgeordnet, hilft vermittelnd bei deren Aktivitäten und sorgt für allgemeine Verbindlichkeit. Abstrakte Kampfbegriffe lösen sich so in konkreten Aufgaben und Maßnahmen auf.
Voraussetzung für diese demokratische Utopie ist natürlich, dass alle Akteure über eine gewisse ethische Reife, oben als „Altersweisheit“ bezeichnet, verfügen. Demokratisches Leben, demokratische Politik hat damit die Bildung des Menschen zu einer umfassend sachorientierten und respektvollen Verantwortlichkeit als Voraussetzung. Das ist zwar keine originelle Erkenntnis; aber originell wäre es, wenn sie (wieder?) ihren festen Platz in der Erziehung von Kindern und Jugendlichen finden würde, möglichst weitgehend lückenlos, damit den wenigen korrupten Egoisten, die so oft an den Schalthebeln der Politik sitzen, mündige Bürger als Gegenwicht gegenübertreten können.
31.10.2022 Souverän bleiben
Seit langem hören wir, dass die USA eine absteigende und asiatische Länder eine aufsteigende Weltmacht seien. Manche Mitbürger, die sich als Freunde der „westlichen Wertegemeinschaft“ verstehen, haben deshalb keine Probleme mit den Kriegen, die die USA einschließlich westlicher Verbündeter seit Jahrzehnten führen – denn die führen sie natürlich nicht aus Eigennutz, sondern nur um die Menschenrechte durchzusetzen, die in den asiatischen Ländern leider nicht so bekannt sind… Andere Mitbürger, die schon immer kritisch gegen den US-Imperialismus eingestellt waren, scheinen rückhaltlos froh darüber zu sein, dass dem Westen zunehmend Paroli geboten wird, sei es von Russland mit militärischen Mitteln, sei es von China mit wirtschaftlichen Mitteln.
Man kann das so sehen und Staatenbünde wie BRICS, Shanghai Cooperation Organisation oder andere als sinnvolle Positionierungen gegen die westliche Vorherrschaft begrüßen. Aber ist das ist ein Grund, diese aufstrebenden Mächte gegen jede Kritik so zu verteidigen als seien sie nun aufgrund ihrer Unabhängigkeitsbestrebungen ausschließlich Vorbilder, denen wir uns anschließen müssen? Manchmal scheinen da manichäische Weltbilder eine moderne Auferstehung zu feiern. Manche sehen beim Blick auf Osteuropa zur Zeit nur die politisch-ökonomisch aggressive westliche Vorgeschichte, wollen aber von der militärisch-aggressiven russischen Gegenwart nichts wissen. Oder sie begrüßen das chinesische Seidenstraßenprojekt ausschließlich unter dem Aspekt des antiimperialistischen Befreiungskampfes, wollen aber von der diktatorischen politischen Kultur, die dabei mittransportiert wird, nichts wissen. Umgekehrt sehen andere nur die russische Aggression in der Ukraine oder die chinesische Parteiführungs-Diktatur ohne etwas von der strategisch wirtschaftlichen Aggressivität des Westens oder den infrastrukturellen Entwicklungschancen durch die Belt & Road-Initiative wissen zu wollen. Das sind nur – nicht ganz beliebige – Beispiele.
Tun wir uns einen Gefallen, wenn wir uns solch einseitigen Sichtweisen in einem kindischen Gut-Böse-Schema anschließen, sei dies nun rechtsrum oder linksrum gestrickt? Nein. Unsere Souveränität bewahren oder erlangen wir nur, wenn wir uns auf unsere eigene Geschichte besinnen, auf das Projekt der europäischen Demokratien im Rahmen nationaler Unabhängigkeiten. Darin eingeschlossen sind selbstverständlich Kontakt und Austausch, wirtschaftlich, politisch, kulturell, mit nahen Nachbarn und fernen Partnern. Aber immer unter eigener selbstbewusster Regie, ob die Partner sich nun im Westen, im Osten oder im Süden befinden.
07.10.2022 Ukrainekrieg
Die Menschheitsgeschichte ist voll von Beispielen dafür, dass Krieg als Fortsetzung von Politik oder einfach als Raubmord-Aktion eines Stärkeren praktiziert wird. Eine Zeit lang haben wir geglaubt, dass dies der Vergangenheit angehören sollte und Krieg nur als Verteidigung, als staatliche Notwehr, akzeptabel sei – und auch das nur als letztes Mittel. Umso erstaunlicher ist es, mit welcher Selbstverständlichkeit nennenswerte Teile der Öffentlichkeit den Krieg wieder als Mittel der Politik akzeptieren. Freilich spielt dabei die Propaganda eine Rolle, mit der jeder Akteur seine Aktivität als Verteidigung von etwas darstellt, selbst wenn er als erster zu den Waffen greift.
Gegen den Vietnamkrieg gab es international und auch bei uns eine protestierende Gegenkultur. Beim Jugoslawienkrieg, der maßgeblich von deutschem Boden ausging, war das bereits anders; schließlich trug ein Teil der ehemaligen Friedensbewegung inzwischen Regierungsverantwortung. Westliche Kriege in Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien galten trotz offensichtlicher Propagandalügen als Verteidigung der Freiheit, wogegen auch immer. Die Beteiligung am Libyenkrieg lehnte der damalige Außenminister Westerwelle ab, was ihm bereits mehr Kritik als Zustimmung einbrachte.
Im Ukrainekrieg sind wir nun so weit, dass öffentlich diffamiert wird, wer die Lieferung deutscher Waffen dorthin kritisiert. Obwohl laut Umfragen eine deutliche Mehrheit der Bürger diese Waffenlieferungen und auch die Sanktionen gegen Russland ablehnt. Parlamentsabgeordnete von links und vor allem von rechts (!) haben als Gegner von Waffenlieferungen ins Kriegsgebiet wenig Chancen auf wirksames Gehör. Manche Teile dieser auch außerparlamentarischen Öffentlichkeit präsentieren sich aber kaum als konsequente Kriegsgegner, sondern haben der Sichtweise, dass Russland hier einen berechtigten präventiven Verteidigungskrieg gegen westliche Bedrohungen führe, oft nichts entgegenzusetzen.
Die Argumente jeder Seite gegen die jeweils andere sind überwiegend zutreffend: ja, die angloamerikanische Welt verfolgt seit dem 19. Jahrhundert das Ziel, Russland und Deutschland nicht gemeinsam stark werden zu lassen. Folglich ist man auf jüngere russische Versuche, ein gemeinsames europäisches Haus zu bauen nicht eingegangen, sondern hat die NATO-Front nach Osten verschoben; die US-Strategen haben Russland bewusst provoziert und mit Sanktionen belegt; man ignorierte den völkerrechtlich verbindlichen Minsk-Vertrag, man munitioniert die Ukraine, einen herausragend korrupten und nationalistischen Staat, für einen Stellvertreterkrieg – nachdem man zuvor einen gewalttätigen Putsch gegen eine nicht ausreichend EU-freundliche Regierung unterstützt hat. Stimmt alles.
Und ja, Russland hat fremdes Territorium angegriffen, Teile davon besetzt und für sich eingenommen, nicht erst im Februar 2022, sondern mehr oder weniger indirekt seit 2014. Als Motive hat Russland mal das Überschreiten roter Linien außerhalb Russlands genannt, mal den Schutz der russischen Bevölkerung in der Ostukraine, mal die Entnazifizierung der ganzen Ukraine inkl. ihrer Regierung in Kiew, mal die Konstruktion einer neuen Weltordnung gegen die vom westlichen Kapitalismus dominierte ungerechte und moralisch verkommene Welt. Die Selbstverteidigung Russland gegen einen drohenden Einmarsch war kaum einmal ein Argument, denn ein solcher Einmarsch stand nicht bevor. Aber ein Einmarsch Russlands in der Ukraine einschließlich zig tausenden Toten, Zerstörungen, Landbesetzungen hat stattgefunden. Und Reden der Kreml-Führung über die Zugehörigkeit der Ukraine zu Russland hat es ebenfalls gegeben.
Wie würde das ostukrainische Volk abstimmen, wenn es zu wählen hätte zwischen ukrainischer Staatsbürgerschaft, ggf. mit mehr Autonomie, oder russischer Staatsbürgerschaft, vielleicht auch mit Autonomie, oder zerstörten Städten, zig tausenden Toten, hunderttausenden Flüchtlingen…? Bezweifelt jemand im Ernst, dass die letztgenannte Option auch die letztgewählte wäre? Aber das Volk ist nicht gefragt worden, frei, gleich, geheim. Nicht vor dem Krieg und schon gar nicht während des Krieges. Sondern es wird von beiden Seiten beschossen gemäß den Entscheidungen politischer Nationalisten und Geostrategen.
Es geht um Machtpolitik auf beiden Seiten, auch wenn die geopolitischen Randbedingungen und die ideologischen Narrative verschieden sind. Machtpolitik nutzt Krieg als Mittel der Politik, das ist leider keine Vergangenheit. Aufgabe der Politiker wäre es aber, dafür zu sorgen, dass die Menschen auf jedem Territorium, egal unter welcher Fahne, in Frieden und Wohlstand leben können. Aufgabe von uns Bürgern ist es, die Politiker darauf zu verpflichten. Jeder in seinem Land. Eine Mehrheit der Deutschen ist laut Umfragen der Meinung, dass im Fall Ukraine sowohl die westlichen Sanktionen gegen Russland und Waffenlieferungen an die Ukraine als auch die russische Invasion und Kriegsführung abzulehnen seien. Die Volksvertreter und Regierenden vertreten leider andere Meinungen. Und handeln anders. Das Volk ist mehrheitlich friedlicher als seine derzeitigen demokratischen Führer…
Nachtrag 15.01.2023: ein bedenkenswertes Interview mit einem Ex-Brigade-General und Ex-Berater von Ex-Kanzlerin Merkel: Erich Vad: Was sind die Kriegsziele? | EMMA
25.09.2022 Trauer um die Queen
Der Tod und die Trauerfeierlichkeiten für die britische Königin haben weltweite Beachtung gefunden. Dabei wurden auch Stimmen laut, die normalerweise nicht zu einem solchen Anlass gehören: Kritik an der Monarchie generell, an dem betriebenen Aufwand der Beerdigung, an der Tatsache, dass sich die Queen niemals für die Verbrechen entschuldigt habe, die im Namen der Krone über Jahrhunderte hinweg begangen wurden…
Das kann man so sehen, auch wenn man weiß, dass dem Königshaus politische Äußerungen (eine Bitte um Entschuldigung für Verbrechen ist eine politische Äußerung, weil sie sofort Schadensersatzforderungen nach sich ziehen würde) untersagt ist. Unabhängig davon zeigen die Trauerbekundungen von hunderttausenden Menschen im United Kingdom und auch anderswo aber noch etwas anderes.
Die Queen war beliebt und geehrt, offenbar deshalb, weil sie ihr ganzes Leben in den Dienst der Aufgabe gestellt hat, die das Schicksal ihr gegeben hat. Natürlich gibt es andere Schicksale als Königin zu sein. Aber es gibt auch Könige die anders damit umgehen. Die Queen mag praktisch, bzw. materiell niemandem viel genützt haben, im Gegenteil, das Königshaus kostet Steuergelder. Aber sie war ein Vorbild hinsichtlich ihrer Lebenseinstellung, die viele Bürger auch als Vorbild für eine nicht königliche Lebensführung verstanden wissen wollten. Das haben sie geschätzt, da sie es von anderen Repräsentanten so nicht kennen. Als junge Frau hatte sie sich verpflichtet, ihren Dienst zu tun, ein Leben lang. Viele ihrer Bürger haben sie in den 70 Jahren mehr als einmal freundlich zu Gesicht bekommen und sich in ihrem Alltag gewürdigt gefühlt. Noch wenige Tage vor ihrem Tod hat sie einmal mehr pflichtgemäß einen Premier verabschiedet und eine neue Premierministerin begrüßt.
Die Wertschätzung der Königin zeigt, dass Menschen gern ein Vorbild haben, an dem sie ihre eigene Einstellung zur verantwortlichen Lebensführung bestätigt und gewürdigt sehen. Das ist auch eine Erziehungshilfe für ihre Kinder, eine Orientierung für den Umgang mit Freunden oder Nachbarn, gerade dann, wenn das Vorbild die repräsentative Funktion hat, die man an der Spitze einer Nation eben hat. In dieser Funktion dient die entsprechende Person als Projektionsfläche für richtiges Tun und Lassen – weshalb es ebenso große Aufmerksamkeit gab, als die Queen beim Tod der Schwiegertochter einmal nicht richtig handelte. Sie kann die Vorbildfunktion in der einen oder anderen Richtung ausüben, aber sie übt sie in jedem Fall aus. „Stell Dich den Aufgaben, die das Leben Dir stellt. Ich tue es auch.“ In dieser Allgemeinheit besteht eine Gemeinsamkeit zwischen Repräsentant(in) und Volk und eine gefühlsmäßige Unterstützung für das tägliche Leben. Solange es politische, bzw. repräsentative Funktionen in einem Staatswesen gibt, ist dies das Beste, was man von einem solchen Amt erwarten kann.
Ob diese ideelle Funktion die Steuergelder wert ist, zumal nicht jeder im Königshaus ähnliches leistet, ist eine andere Frage. Übrigens liefert das Haus Windsor durch sein Vermögen und seine eigenen wirtschaftlichen Aktivitäten mehr Steuergelder ab als es selbst beansprucht (NZZ 23.09.2022). Jedenfalls spricht nichts dagegen, sich vorbildliche politische Repräsentanten zu wünschen, am besten sogar in politischen Funktionen auf allen Ebenen.
