Genauer betrachtet
Direktere Demokratie
Unter dieser Überschrift werden verschiedene Aspekte behandelt: die direkten Abstimmungsmöglichkeiten in Deutschland, die Gemeinde als eine eigentliche Zelle von Demokratie, die Parteien, die eine zu starke Position entgegen direkterer Demokratie haben, obwohl sie sicher notwendig sind.
Die Abstimmungen
Im Folgenden zeige ich zunächst die unmittelbar direktdemokratischen Möglichkeiten, die wir in Deutschland haben. Auf Bundesebene ist der Grundgesetzauftrag nach Volksabstimmungen (siehe „Kernthemen_Direktere Demokratie„) bis heute nicht realisiert und wird von keiner politischen Kraft maßgeblich vorangetrieben.
Auf Landesebene gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, zu manchen Themen Abstimmungen durchzuführen. Quelle: https://www.forschungsinformationssystem.de/servlet/is/351995/

Länderspezifischen Regelungen der Volksentscheide und Volksbegehren EG= einfache Gesetzesänderung, VÄ = Verfassungsänderungen; A= Unterschriften werden auf dem Amt gesammelt; F= Unterschriften werden frei gesammelt; *Zustimmungsquorum = Mindestanteil der stimmberechtigten Bevölkerung muss teilnehmen; **Initiative statt Zulassung = statt einer Mindestanzahl an Unterschriften wird der Antrag des Volksbegehrens vom Landtag geprüft; ***kein Quorum = in Sachsen-Anhalt entfällt das Zustimmungsquorum, wenn vom Parlament eine Konkurrenzvorlage zur Abstimmung gestellt wird.
In den Gemeinden gelten in den einzelnen Bundesländern, die dies zentral für ihre Gemeinden bestimmen, folgende Regelungen

Diese Abstimmungsmöglichkeiten werden auch genutzt: 1990 – 2012 gab es 6.345 Bürgerbegehren, davon wurden 2.767 zu Bürgerentscheiden, davon waren 1.444 erfolgreich.
Natürlich ist es die Angelegenheit der jeweiligen Ebenen, ihre Regelungen selbst zu bestimmen. Aber wer hat diese Regelungen tatsächlich beschlossen? Das geschah nicht auf direktem, sondern auf „repräsentativem“ Weg in den Landesparlamenten. Konsequent wäre es, die jeweiligen Abstimmungseinheiten (Gemeinde, Landkreis, Land) einmal direkt darüber abstimmen zu lassen, über welche Themen sie in Zukunft auf welche Weise direkt abstimmen können möchten. Dabei sollte es folgende Abstimmungsoptionen geben: 1. nach einem erfolgreichen Zulassungsquorum für eine Initiative gibt es kein Zustimmungsquorum mehr bei ihrer Durchführung; 2. die Abstimmungsgegenstände dürfen dieselben sein wie die, die auf der repräsentativen Ebene gegeben sind.
Über diese beiden Optionen sollte auch auf Bundesebene abgestimmt werden dürfen, um dort endlich den Grundgesetzauftrag Art. 23 einzulösen, dass alle Staatsgewalt auch durch Volksabstimmungen ausgeübt werde.
Die Gemeinde
Ebenfalls zum Thema direktere Demokratie gehört die Gemeinde, bzw. die Gemeindeautonomie, die eigentliche Basis demokratischer Ordnung. Die Gemeindeautonomie funktioniert heute nicht (mehr) überall so überschaubar und direkt wie man das hier bei der kantonalen Landsgemeinde in Glarus, Schweiz, sieht.

Im Folgenden ist auch nicht von Ländern wie China oder Indien die Rede, in denen es unzählige Städte gibt, die jeweils mehr Einwohner haben als ganz Portugal und auch nicht von Staaten auf anderen Kontinenten, in denen es vielleicht gar keine Traditionen städtischer Gemeindeautonomie gibt, siehe hierzu den Zwischenruf vom 02.06.2024.

Wie sich dort demokratische Aufgaben im föderalen Sinn stellen, ist hier nicht das Thema. Im Folgenden geht es um unser Land Deutschland, vielleicht noch mit Blick auf europäische Nachbarn, wo es Gemeindestrukturen und Landkreise gibt, die als politische Einheiten definiert sind und als solche mehr oder weniger gut funktionieren. Es geht um die Frage, ob oder wie sie besser funktionieren könnten.
Die Gemeinden mit ihrer Selbstverwaltung blicken in Deutschland in modernerer Zeit auf eine 200jährige Geschichte zurück. Wenn man noch die Geschichte des Heiligen Römischen Reiches „Deutscher Nation“ (962–1806) hinzunimmt, dann sieht man eine große und wechselvolle Vielfalt von kommunalen Selbständigkeiten. Allein in den wenigen Jahrhunderten des hohen Mittelalters wurden in Deutschland nahezu 3.000 Städte gegründet, die zu einem großen Teil politisch relativ selbständig waren. Heute gibt es in Deutschland – dank Eingemeindungen – noch ca. 2.000 Städte und insgesamt (Stand 2016) 11.059 Gemeinden, 294 Landkreise und 107 kreisfreie Städte. 40 Jahre vorher hatte es noch 24.438 Gemeinden gegeben.
Anders als z. B. in Großbritannien und Schweden haben die Gemeinden in Deutschland heute keine getrennte Verwaltungsstruktur (mehr) neben der staatlichen Verwaltung, sondern sind in diese eingebunden und damit zugleich – wie die Bundesländer – auch Ausführungsorgane der übergeordneten staatlichen Entscheidungsebenen. Wie funktioniert die innere Demokratie in den Gemeinden?
Die Gemeindeordnungen sind in den Bundesländern nicht einheitlich, sondern zwischen den Bundesländern unterschiedlich. Ausgangspunkt nach dem Zweiten Weltkrieg waren Einflüsse der Amerikaner, die stärker auf direktdemokratische Elemente setzten, und der Briten, die starke Kommunalparlamente bevorzugten, mit einem eher nur ausführenden Verwaltungsleiter. Diese Unterschiede sind bis heute im amerikanisch geprägten Süden und im britisch geprägten Norden unseres Landes spürbar, obwohl mit Reformen in den 1990er Jahren eine stärkere Vereinheitlichung stattgefunden hat. Seitdem gibt es überall direkt gewählte Bürgermeister, die zugleich die Funktion eines Verwaltungschefs ausüben. Darunter gibt es die professionelle und nicht gewählte Verwaltungsebene und den gewählten Rat, der kein Parlament im legislativen Sinn ist, sondern ein politisches Entscheidungsgremium zu Sachfragen. Unterschiede gibt es weiterhin: In Süddeutschland ist der Bürgermeister nicht nur Verwaltungschef, sondern auch Ratsvorsitzender und hat damit größere Befugnisse als der Bürgermeister in Norddeutschland sowie in Hessen, wo der Rat ein stärkeres Gewicht gegenüber dem Bürgermeister hat.
Die Ratsmitglieder sind keine Berufspolitiker, sondern bekommen für ihre zeitweilige Arbeit sehr überschaubare Aufwandsentschädigungen. Teilweise können sie von ihren beruflichen Aufgaben freigestellt werden, was auch dazu führt, dass sich die Gemeinderäte überproportional aus Selbständigen, leitenden Angestellten aus der Privatwirtschaft, Beamten und öffentlichen Angestellten sowie Rentnern zusammensetzen.
Die Parteibindung von Ratsmitgliedern und Bürgermeistern ist weniger deutlich ausgeprägt als auf den übergeordneten staatlichen Ebenen Land und Bund. Aber auch hier gibt es Unterschiede, von Nordrhein-Westfalen mit den stärksten Parteibindungen bis Baden-Württemberg mit den geringsten. Auf der Gemeindeebene spielen fast überall zunehmend freie Wählervereinigungen und auch direkte Bürgerbeteiligungen eine Rolle. Welche Kompetenzen haben die Gemeinden überhaupt? Rudzio (siehe Bibliothek) fasst es in seinem Standardwerk so zusammen: «Die Gemeinden und Kreise sind nur Hintersassen der Bundesländer.»
Über die Kommunalverfassungen entscheiden nicht die Gemeinden selbst, sondern die Landesparlamente. Die Kommunen dürfen über ihre Einrichtungen wie Schulbauten, Verkehrsbetriebe, Kultureinrichtungen, Gemeindestrassen, Bebauungspläne, Landschaftsschutz, Abfallbeseitigung usw. entscheiden. Darüber hinaus sind sie Ausführungsorgane für die von Land und Bund beschlossenen Gesetze zur Sozialhilfe, Jugendhilfe, Wohngeld, Immissionsschutz, Lebensmittelrecht usw. Diese «übertragenen Aufgaben» machen 75–90 % der kommunalen Verwaltungstätigkeit aus.
In zunehmendem Maß sind viele der kommunalen Aufgaben in der Vergangenheit an ausgelagerte autonome Einheiten oder an private Unternehmen übergeben worden. Das hat gemäß einer Umfrage von 2005 etwa 15–20 % der kommunalen Aufgaben betroffen, bis hin zur Privatisierung von ganzen Wasserwerken. Allerdings hat hier vor allem dank verschiedener Bürgerentscheide teilweise wieder eine Rekommunalisierung stattgefunden.
Entscheidend ist die Frage der finanziellen Autonomie der Gemeinden. Eigene Mittel erhält die Gemeinde vor allem aus der Gewerbesteuer, der Grundsteuer und den Gebühren für ihre Leistungen, wobei diese maximal kostendeckend sein, also keinen Gewinn erwirtschaften dürfen. Diese Einnahmen zusammen decken weit weniger als die Hälfte des Haushaltes. Der «Rest» wird aus Zuweisungen von der höheren staatlichen Ebene zugeteilt. Der nahezu einzige eigene Hebel, den die Gemeinden selbst beeinflussen können, ist also die Gewerbesteuer, was dazu führt, dass eine kostenmindernde Konkurrenz um Gewerbeansiedlungen zwischen den Gemeinden stattfindet und in strukturschwachen Gebieten, vor allem im Osten, die Abhängigkeit vom Staat noch grösser ist.
Der ständige Kampf der Gemeinden gegen die Verschuldung, die aus einem strukturellen Missverhältnis zwischen Aufgabenzuweisung und Finanzierung resultiert, ist keine gute Einladung für die Bürger zum persönlichen Engagement. Manchmal kommt auch noch selbstverschuldete Misswirtschaft oder Korruption des gewählten oder des professionellen Personals hinzu. Trotzdem gibt es keine Alternative zum zivilgesellschaftlichen Engagement unter Nutzung der institutionalisierten Möglichkeiten.

Die Parteien
Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit, das ist ihre grundgesetzliche Funktion; nicht mehr und nicht weniger (Art. 21 GG). Faktisch finden aber praktisch keine nennenswerten Entscheidungen auf Bundes- und auf Landesebene statt, ohne dass dies durch den Filter von Parteigremien gegangen wäre. Das gilt sowohl legislativ als auch exekutiv. Vielfach werden auch wichtige öffentliche Ämter, Verwaltungsstellen, sogar Richterposten nach parteipolitischen Kräfteverhältnissen vergeben. Das ist so im Grundgesetz nicht vorgesehen. Und es bewirkt eine Behinderung direkterer, an der jeweiligen Sache orientierter Entscheidungsvorgänge.
Denn leider hat man den Parteien im Lauf der bundesrepublikanischen Geschichte das Recht auf eine fast ausschließliche Repräsentation des Bürgerwillens zugestanden. Maßgeblich beteiligt war der Carl-Schmitt-Schüler Gerhard Leibholz, der 20 Jahre lang am Bundesverfassungsgericht durch seine Urteile die deutsche Demokratie von einer Bürger-Souveränität in Richtung eines Parteien-Repräsentationssystems gelenkt hat. Hierzu Prof. Schachtschneider „Die nationale Option“ (siehe Bibliothek):
„Man sollte den Begriff der Repräsentation nicht verkennen. Die überwiegende Staatsrechtslehre spricht bezeichnenderweise nicht von der „Vertretung des ganzen Volkes“, wie das im Grundgesetz in Art. 38 steht, sondern von der Repräsentation, die kaum einer so ganz versteht. Das Grundgesetz kennt den Begriff der Repräsentation nicht. Er wurde von Carl Schmitt und dessen Schüler Gerhard Leibholz in die Verfassungsrechtslehre der Demokratie eingeführt. Carl Schmitt hat seine Repräsentationslehre der katholischen abgeschaut, wonach die Kirche und/oder der Papst das Unsichtbare, nämlich Gott, sichtbar machen, Die Repräsentanten des Staates würden das ebenso unsichtbare Volk als politischer Einheit sichtbar machen… Den Bürger als Politiker kennt Carl Schmitt nicht.“ (S. 72)
Gerhard Leibholz, ein Schüler von Carl Schmitt, war in der frühen Bundesrepublik 20 Jahre lang als Bundesverfassungsrichter maßgeblich daran beteiligt, mit dieser Sichtweise „den vom Grundgesetz verfassten Bürgerstaat in einen Parteienstaat zu verwandeln“ (S. 73), was dazu geführt hat:
„Die Parteien sind im Wahlrecht privilegiert, das Fraktionswesen des Parlamentsrechts ist auf die Parteien ausgerichtet, sie werden weitgehend vom Staat finanziert, ihnen mangelt die innere Demokratie, …sie betreiben strafbar Ämterpatronage, sie unterlaufen die Gewaltenteilung, sie verbünden sich mit den Mächtigen in der Wirtschaft und in den Medien…“ (S. 68 f) und so weiter.
Aus berufenem Munde erfahren wir hier also, dass die Bundesrepublik als Parteienstaat maßgeblich das Werk eines Verfassungsrichters sei und dass dabei nicht das Grundgesetz, sondern der Jurist Carl Schmitt Pate gestanden habe, dessen Kariere bekanntlich nicht mit demokratischen Verdiensten geschmückt ist. Zweifellos ist die Geschichte bei genauerer Betrachtung komplexer, aber es bleibt die Erkenntnis, dass es sich bei dieser „Weiterentwicklung“ des Grundgesetzwillens um ein Menschenwerk handelt, das auf relativ einsamen richterlichen Entscheidungen fußt und keineswegs so hätte geschehen müssen.
Natürlich soll nicht bestritten werden, dass Parteien historisch und funktional eine wichtige Rolle in der Geschichte gespielt haben und auch noch spielen mögen. Es handelt sich um kollektive Interessenvertretungen innerhalb eines Gemeinwesens, die in mehr oder weniger zivilisierter Form gegeneinander auftreten und – im besten Fall – Kompromisslösungen zwischen konkurrierenden Interessen finden. Es handelt sich um gesellschaftliche Lobbygruppen, die – anders als man sonst Lobbyarbeit versteht – öffentlich agieren und sich um Einfluss in der Legislative und in der Exekutive bemühen.

In der Geschichte haben sich sozial schwache Gruppen dadurch viele Stärkungen errungen, Gewerbetreibende haben sich Freiheiten errungen, die von anderen Interessengruppen, welche unter diesen Freiheiten leiden mussten, wieder beschnitten wurden. Parteien sind mit dem Anspruch des Umweltschutzes oder aus nationalem Stolz oder anderen Motiven heraus gegründet worden, die kein spezifisches Merkmal einer bestimmten Berufsgruppe sind, sondern den politischen Willen zu einer bestimmten Sache in den Vordergrund stellen. Nicht selten treten Parteien mit dem Anspruch auf, besser als alle anderen für das Gemeinwohl einzutreten, wofür eine Zeit lang der Begriff „Volkspartei“ modern war.
Dieser Begriff ist natürlich ein Widerspruch in sich selbst, denn der Begriff Partei kommt aus dem Lateinischen von pars = Teil. Eine Partei vertritt definitionsgemäß ein Teilinteresse, nicht das Ganze. Das gute Ganze kann in diesem Sinne nur durch den Ausgleich zwischen den Teilen entstehen. Insofern können Parteien als notwendiger Bestandteil demokratischer Vorgänge sehr hilfreich sein. Seit geraumer Zeit beobachten wir allerdings, dass die meisten unserer Parteien sich zwar nicht mehr Volksparteien nennen, aber zunehmend mit einem Selbstverständnis auftreten als wäre der Gemeinschaft am besten gedient, wenn sie allein das Sagen hätten.
Betrachtet man die historische Herkunft unserer aktuellen Parteien, so fällt auf, dass es heute vor allem darum geht, mit Bezug auf die historische Herkunft der Partei und ihr entsprechendes Image ein Stammwählerreservoir zu halten. Das muss nicht allzu deutlich mit den Politikinhalten korrespondieren, die man dann in Regierungs- oder auch nur Gesetzgebungsverantwortung praktiziert. Man bekommt den Eindruck, als handele es sich bei den Parteien heute eher um Firmen, die alle sehr ähnliche Ziele verfolgen, nämlich Arbeitsplätze für Berufspolitiker zu schaffen. Sie verfolgen dabei verschiedene Akquisitionsmodelle, je nach Parteifarbe, weil die Kundschaft, sorry: die Wählerschaft, eben verschiedene Geschmäcker hat.
Aber nein, natürlich gibt es viele ehrliche Menschen unter den Parteimitgliedern, vor allem an der Basis. Fraglich nur, ob diese Ehrlichkeit ein Karrierevorteil ist. Aber um der Wahrheit die Ehre zu geben: zum Thema Parteien gehört auch, dass unser politisches System in diesem Zusammenhang sich ziemlich vorbildlich um demokratische Gerechtigkeit bemüht hat: ich meine das Wahlsystem.
Während in anderen Ländern mit Mehrheitswahlrecht viel demokratischer Wille der Bürger auf der Strecke bleibt (the winner takes it all), gibt es bei uns ein Proporzsystem, das es auch kleineren Parteien, also theoretisch kleineren Interessengruppen, erlaubt, in den Parlamenten vertreten zu sein. Das ist gut so. Und man hat parallel ein Persönlichkeitswahlsystem, um eine Art Parteiunabhängigkeit zu betonen. Auch das ist gut so. Das doppelte Wahlsystem mit 2 Stimmen führt in seiner Gerechtigkeitskonsequenz leider dazu, dass durch Ausgleichsmandate das Parlament immer größer wird – das ist weniger gut so.
Die Wahlrechtsreform 2023
Der Verein Mehr Demokratie e.V. hat 2012 beim Bundesverfassungsgericht gegen gewisse Widersprüchlichkeiten in unserem Wahlsystem geklagt und erreicht, dass das Wahlgesetz angepasst werden muss. Die Politiker verbinden diese Aufgabe zugleich mit der Absicht, die Zahl der Abgeordneten, die durch Ausgleichs- und Überhangmandate immer größer geworden ist, zu reduzieren.
Grundsätzlich folgt unser Wahlsystem der guten Idee, jeden Wahlkreis mit einer natürlichen Person zu vertreten, zugleich aber durch dieses Mehrheitswahlsystem entstehende Ungerechtigkeiten hinsichtlich des Parteienproporzes durch eine Zweitstimme zu korrigieren. Dadurch sind mit der wachsenden Anzahl der Parteien im Bundestag immer mehr Abgeordnete entstanden, weil die kleineren Parteien kaum angemessen Wahlkreissieger hervorbringen, was zum Anwachsen der Ausgleichsmandate geführt hat.
Im ersten Schritt hatte man zunächst beschlossen, die Zahl der Wahlkreise von 299 auf 280 zu verringern und nicht alle Überhangmandate auszugleichen, sondern dies erst ab dem dritten zu tun. Das war ein Schritt in die falsche Richtung, der schwammig willkürlich war und wird wenig bewirken würde. Die Parlamentsentscheidung vom 17.03.2023 kassiert diesen Beschluss wieder und geht statt dessen größere Schritte in die falsche Richtung: Es wird ein vorrangiges Verhältniswahlrecht eingeführt, das durch eine Personenwahl unvollständig ergänzt wird. Erststimmensieger (Personen) können gestrichen werden, wenn sie zu stark von den Zweitstimmen (Partei) abweichen. Bis zu 330 (statt 299) Abgeordnete können von den Parteilisten ergänzt werden, um Erststimmenüberhänge auszugleichen. Falls das nicht reicht, werden die Erststimmensieger mit den schlechtesten Prozentzahlen gestrichen; nicht jeder Wahlkreis würde dann einen persönlich gewählten Vertreter haben!
Außerdem hat man beschlossen, eine Partei nicht entsprechend dem Zweitstimmenergebnis in den Bundestag zu lassen, wenn sie bundesweit nicht 5 % der Stimmen erreicht, und zwar auch dann nicht, wenn sie beliebig viele Direktkandidaten in den Bundestag bringt. Das kann man zwar demokratisch vertreten (denn die über 40 direkt gewählten CSU-Abgeordneten – zum Beispiel – können ja trotzdem eine Fraktion bilden), man könnte aber auch die 5 % Klausel herabsetzen, denn es ist demokratisch kaum zu vertreten, dass Millionen Stimmen unbeachtet bleiben.
Gar nicht vertreten kann man dagegen, dass manche Wahlkreise ohne persönlichen Abgeordneten bleiben, während die meisten anderen Wahlkreise einen solchen haben. Bei der Bundestagswahl 2021 wären damit über 20 Wahlkreise nicht mit einem persönlichen Wahlsieger vertreten gewesen. Die Erststimmenwahl in diesen Wahlkreisen hätte ebensogut unterbleiben können, aber man wusste vorher ja nicht, welchen Wahlkreis das treffen würde…Das ist wie russisches Roulette und wäre keine gleiche Wahl mehr, wie das Grundgesetz, Artikel 38, sie fordert. Wo bleibt die Gleichheit, wenn viele Wahlkreise einen persönlichen Abgeordneten haben, manche aber nicht? Es ist zu hoffen, dass das Bundesverfassungsgericht dies erkennt.
Reformvorschlag zur Wahlrechtsreform
Die Grundidee, dass jeder Wahlkreis einen persönlichen Abgeordneten hat, eben den Wahlsieger, und dass außerdem der Parteienproporz richtig abgebildet wird ohne dass ein Übermaß an Abgeordneten entsteht, ist relativ einfach zu realisieren, wenn man denn will. Dazu sind zwei Punkte notwendig: Erstens müssen nicht alle Wahlkreise mit einer Zweitstimme vertreten sein; denn diese ist – zu Recht! – nur dazu da, die mangelhafte Repräsentation des Erststimmen-Mehrheitswahlrechts auszugleichen. Zweitens müssen die Erststimmen bei einer Bundestagswahl nicht nach Bundesländern getrennt durch Zweitstimmen ausgeglichen werden, sondern nur einmal bundesweit. Damit würden sich Ungleichgewichte in verschiedenen Regionen bereits automatisch teilweise ausgleichen.
Beide Punkte sind demokratisch und grundgesetzlich völlig unbedenklich, denn die Zweitstimme bezieht sich nicht auf eine Person, sondern auf eine Partei; es besteht kein persönlicher Anspruch. Eine bundesweite (nicht landesweite) Parteilistenführung ist deswegen gerecht, weil es sich um eine Bundestagswahl handelt; jeder Abgeordnete hat das ganze deutsche Volk, nicht sein „Landesvolk“ zu vertreten. Für Landesinteressen auf Bundesebene gibt es den Bundesrat. (Davon abgesehen hat der Abgeordnete sowieso nicht seine Partei, sondern eben das ganze Volk zu vertreten, ist an keinerlei Weisung gebunden und nur seinem Gewissen unterworfen.) Wie die Landesparteien sich auf eine Bundesliste einigen, ist deren Aufgabe. Das gilt auch für CDU/CSU, die ohne weiteres ein Listenbündnis eingehen kann. Mit diesem System wird die Persönlichkeitswahl für jeden Wahlkreis gewahrt, das Parteienverhältnis als „Minderheitenschutz“ ebenfalls, und die Zahl der Abgeordneten wird reduziert. Die Persönlichkeitswahl für jeden Wahlkreis darf schon deswegen nicht angetastet oder relativiert werden, weil damit auch parteilose Personen eine Chance zum Wahlsieg behalten.
Die gute Idee einer Kombination von Mehrheits-(Personen)-wahl und Verhältnis-(Parteien)-wahl wäre damit realisiert bei gleichzeitig deutlicher Reduktion der Abgeordnetenzahl auf weniger als 2 x die Wahlkreisanzahl. Selbstverständlich können – wie bisher – auch parteilose Abgeordnete in den Bundestag gewählt werden, auch wenn das bisher noch nicht nicht vorgekommen ist. Einer hat bei der Wahl 2021 immerhin 9 % der Stimmen seines Wahlkreises geholt.
Bezieht man diesen Reformvorschlag auf die Bundestagswahl 2021, so ergibt sich folgendes Bild:
| Partei | Partei-ergebnis 2021 in % | Anzahl Direkt-mandate 2021 | % Anteil der Direkt-mandate | Plus Sitze von den Bundeslisten | Summe Sitze | Zahl der Sitze in % stimmt mit dem Wahlergebnis der Parteien überein |
| CDU/ CSU | 24,1 | 143 | 48 | 0 | = 143 | 26,5 |
| SPD | 25,7 | 121 | 40 | + 31 | = 152 | 28,0 |
| AfD | 10,3 | 16 | 5,5 | + 45 | = 61 | 11,3 |
| FDP | 11,5 | 0 | 0 | + 68 | = 68 | 12,5 |
| Linke | 4,9 | 3 | 1 | + 26 | = 29 | 5,5 |
| Grüne | 14,8 | 16 | 5,5 | + 72 | = 88 | 16,2 |
| sonstige | 8,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | verteilt auf die anderen |
| Summe | 100 | 299 | 100 | + 242 | = 541 | 100 |
Für den Fall, dass z.B. CDU und CSU keine Bundesliste eingehen wollen, wäre auch eine bundesweite 3 %- Hürde angemessen. Diese könnte auch eine weitere Ungerechtigkeit, nämlich die Nichtbeachtung von mehreren Millionen Stimmen, mindern.
parteilose Volksvertretung
Die Erststimmenkandidaten sind heute fast ausschließlich Parteikandidaten, abgesichert auf ihren Landeslisten für die Zweitstimme. Sie kommen auf jeden Fall ins Parlament, wenn die Partei ins Parlament kommt. (Zumindest war das so bis zu dem gleichheitswidrigen Bundestagsentscheid vom 17.03.2023.) Es ist übrigens keine echte Persönlichkeitswahl, denn die Aufstellung der Kandidaten geschieht durch die Parteien. Es gibt Initiativen für die Aufstellung von parteiunabhängigen Bürgerkandidaten. Unser Wahlgesetz lässt das sogar ziemlich einfach zu: Ein Kandidat braucht dafür 200 Unterschriften aus seinem Wahlkreis. Dafür bekommt er aber keinerlei öffentliche Unterstützung, während die Parteien massive öffentliche Unterstützung genießen durch öffentliche Finanzierung, Privilegierung in den Parlamenten durch einen Fraktionsstatus, Bevorzugung bei der Besetzung wichtiger öffentlicher Ämter usw. Die Parteien finanzieren sich nicht nur durch Mitgliederbeiträge und Spenden. Sie bekommen für jeden Euro Beitrag oder Spende zusätzlich 0,38 Euro vom Staat. Sofern sie bei Wahlen mindestens 0,5 % der Stimmen erreichen, erhalten sie pro Stimme 0,70 Euro vom Staat. Die Parteien müssen ihre Einnahmen offenlegen, was zumindest teilweise auch geschieht; schließlich gibt es ja zusätzliches Geld aus Steuermitteln dafür! Das alles sind Privilegien, von denen das Grundgesetz nichts weiß. Von einem «Fraktionszwang» weiß es schon gar nichts; diesen gibt es nicht (Art. 38 GG), auch wenn die meisten Abgeordneten sich aus Karrieregründen so verhalten, als gäbe es ihn.


Parteiunabhängige Direktkandidaten hat es zwar immer wieder gegeben; gewählt wurde seit 1950 aber niemand. Bei der Bundestagswahl 2017 hat der erfolgreichste parteiunabhängige Direktkandidat – immerhin – 9 % der Stimmen seines Wahlkreises bekommen. Andere blieben unter 1 %.
Warum müssen den Parteien auf die Mitgliedsbeiträge und Spenden noch Steuergelder draufgelegt werden? Ja, ohne die Steuergelder wären die Parteien ärmer. Vielleicht könnten sie dann bei Wahlkämpfen nicht quadratkilometerweise nichtssagende Plakate verkleben und ebensolche Werbespots in Fernsehen und Rundfunk platzieren. Die Welt wäre dadurch nicht ärmer. Warum soll man solche Verschwendung nicht finanziell austrocknen oder einfach verbieten? Tabakreklame konnte ja auch verboten werden. Mit dem gesparten Geld könnte der Staat das unterstützen, was unser Wahlrecht eigentlich will: eine Persönlichkeitswahl von Abgeordneten, die ein Gewissen haben, daneben gerne einen Ausgleich wegen der Ungerechtigkeit des reinen Mehrheitsprinzips. Man könnte in jedem Wahlkreis zumindest zeitweise ein Büro einrichten, in dem vor allem parteiunabhängige oder generell Erststimmen-Kandidaten, die eine Mindestunterstützerzahl nachweisen können, sich persönlich präsentieren, dem Mitbürger und Wähler Rede und Antwort stehen. Man könnte eine offizielle bundesweite digitale Plattform einrichten, auf der diese Kandidaten sich und ihre politischen Vorstellungen für jedermann sichtbar darstellen können.
Man könnte auch verbieten, dass Direktkandidaten auf einer Parteiliste abgesichert sind; für den Parteierfolg gibt es ja die Zweitstimme. Die Persönlichkeit soll überzeugen, nicht die Zelle eines Parteikörpers. Natürlich können dann immer noch Parteikandidaten mit der Erststimme gewählt werden und damit das Gewicht der größeren Parteien stärken. Aber vielleicht bewerben sich dann auch gar nicht so viele Parteikandidaten direkt, weil sie eben über die Parteiliste ins Parlament kommen wollen – und geben so parteiunabhängigen Bewerbern mehr Chancen. Jedenfalls bestünde die Chance, dass bei staatlicher Unterstützung auch der Erststimmenkandidaten (unabhängig von Parteizugehörigkeit) und bei gleichzeitiger Reduktion der Steuermittel für die Parteien, mehr Bürger gewählt werden würden, die unabhängig von Karriereplänen für eine bestimmte Sache engagiert sind. Diese müssten nicht zwingend die Ochsentour durch eine Partei auf sich nehmen, bei der ihre einstige Sachorientierung oft auf der Strecke bleibt oder parteipolitisch «geradegebogen» wird.
Weitere Vorschläge: In den Parlamenten darf es keine Fraktionsprivilegierung geben. Jeder einzelne Abgeordnete muss gleichen Zugang zu allen Informationen und Entscheidungsebenen haben. Und: Die willkürliche 5 %-Klausel sollte gesenkt werden. Millionen Stimmen für kleinere Parteien gehen damit verloren. Ein Erststimmenkandidat vertritt etwa 200 000 Bürger seines Wahlkreises. Nimmt man diese Zahl als Maßstab, wäre eher eine 0,5 % Klausel demokratisch gerecht. Die «praktische Wahrheit» mag dazwischen liegen. Das Parlament muss wieder der Ort der Debatten über die Gesetzgebung im Interesse des Gemeinwohls werden, unter Berücksichtigung möglichst vieler Stimmen aus der Bürgerschaft. Vieles steht dagegen, aber sicher nicht das Grundgesetz.
Es bleibt der Grundgedanke: Institutionelle Strukturen, die eine Beteiligung der Bürger am politischen Leben erleichtern, werden diese Beteiligung auch befördern. Und eine direktere Beteiligung der Bürger am politischen Leben wird Tendenzen bei den politischen Akteuren, die sich nicht am Gemeinwohl und der ehrlichen Vermittlung verschiedener Interessen orientieren, erschweren. Das ist eine Perspektive für eine direktere Demokratie.
Bürgerräte
Seit einigen Jahren hört man immer öfter von Bürgerräten als einer neuen Möglichkeit für demokratisches Leben. Vorbild war eine Initiative in Irland, bei der auf diesem Weg Entscheidungen zur gleichgeschlechtlichen Ehe und zum Abtreibungsverbot vorbereitet wurden. In Deutschland ist vor allem der Verein Mehr Demokratie e.V. aktiv in Sachen Bürgerräte und hat 2019 dazu eine erste Veranstaltung lanciert. 160 Bürger wurden aus Melderegistern zufällig ausgewählt und haben Empfehlungen zur Stärkung der Demokratie erarbeitet. Die Auswahl soll soziologisch repräsentativ gewesen sein hinsichtlich Alter, Geschlecht, Beruf, Bildung etc., was bei der Bezugsquelle Melderegister allerdings Fragen hinsichtlich ausreichender Vollständigkeit oder aber des Datenschutzes aufkommen lässt.
Hintergrund für die Initiative des Vereins war die Vereinbarung im Koalitionsvertrag der letzten von Kanzlerin Merkel geführten Regierung aus dem Jahr 2018, dass eine Expertenkommission zum Thema Stärkung der Demokratie eingerichtet werden sollte. Damit war zunächst die Hoffnung verbunden, dass diese Kommission endlich nach 70 Jahren den Grundgesetzauftrag (Art. 20,2 GG) zur Einführung von Volksabstimmungen auf Bundesebene gesetzlich umsetzt. Diese Kommission wurde jedoch gar nicht eingerichtet, sondern stattdessen wurde unter der Schirmherrschaft des Bundestagspräsidenten der genannte Bürgerrat einberufen. Seitdem wurden weitere Bürgerräte gebildet, zum Beispiel zum Thema Klimaschutz. Auch in Frankreich, Großbritannien und in anderen europäischen Ländern geschieht dies ebenfalls seit 2020, zum Teil mit öffentlicher Unterstützung durch höchste politische Ebenen, in Frankreich durch Präsident Macron persönlich.
Der Verein Mehr Demokratie e.V., der sich seit Jahrzehnten für die Durchsetzung der direkten Demokratie durch Volksabstimmungen auf Bundesebene eingesetzt hatte, sieht Bürgerräte inzwischen als sinnvolle Ergänzung zu direkten Abstimmungen – für die der Verein sich nun aber offenbar nicht mehr so stark einsetzt wie für Bürgerräte auf allen Ebenen: lokal, regional, national, EU-weit. Für die Einberufung eines Bürgerrates braucht es eine Vorbereitungsgruppe, die das Thema festlegt und die ganze Sache organisiert, auch indem den ausgelosten Bürgern echte Experten als Berater zur Seite gestellt werden; dieses „Organisatorische“ erledigt eine Arbeitsgruppe im Verein Mehr Demokratie, unterstützt von einigen privaten Stiftungen. Am Ende gibt es eine Empfehlung an ein zuständiges Parlament (Land, Bund, EU) oder einen zuständigen Gemeinderat, der dann ggf. über die Empfehlungen zu entscheiden hat, siehe dazu diese Kurzbeschreibung: https://www.buergerrat.de/wissen/wie-funktioniert-ein-buergerrat/

Man könnte das Ganze also als eine Art Petitions-Kollektiv bezeichnen mit zufällig ausgelosten Teilnehmern, die von einer selbsternannten Vorbereitungsgruppe ein Thema vorgesetzt bekommen, selbst aber keine Entscheidungskompetenz haben; letzteres ist selbstverständlich zu begrüßen, denn eine solche Arbeitsgruppe hat ja keinerlei demokratische Legitimation. Es ist eine Art pressure group von privat unterstützten politischen Organisationen (Mehr Demokratie e.V. und andere); diese sind Initiatoren und legen den Inhalt der Kampagnen fest. Inzwischen gibt es seit 2022 im Deutschen Bundestag ernsthafte Bestrebungen, dieses „Format“ Bürgerrat langfristig zu etablieren, um die Demokratie zu stärken. https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2022/kw47-forum-w-buergerraete-918446
Man fragt sich, warum diese Bürgerräte so viel Wohlwollen und Unterstützung seitens der hohen Politik bekommen (Präsidentinnen des Deutschen Bundestages, Staatspräsident Frankreichs), während der Grundgesetzauftrag nach Volksabstimmungen offenbar auf ein historisches Abstellgleis geschoben wurde. Mit dem Bürgerrat schaffen sich politisch interessierte Gruppen ein Format, um Bürgerbeteiligung für ihre Anliegen zu demonstrieren. Ist das nicht ein allmähliches Unterlaufen demokratischer Strukturen durch parallele Meinungsbildungskampagnen, denen ein demokratischer Anschein gegeben wird, da hier sogenannt normale Bürger zu Expertisen aufgefordert und von hohen Mandatsträgern dafür gelobt werden? Das passt zu dem Trend, dass in zunehmendem Maß auch diverse andere „Nicht“regierungsorganisationen mit verschiedenen Aktionen und Formaten die öffentliche Agenda prägen. Die Themen der Bürgerräte in verschiedenen europäischen Ländern (auch Belgien, Luxemburg, Finnland, Österreich, Montenegro, Spanien, Dänemark und andere) sind hauptsächlich Klimawandel, Biodiversität, Geschlechtergerechtigkeit etc. aber auch ein paar andere. Es handelt sich um eine koordinierte politische Bewegung, die wohl kaum zufällig fast gleichzeitig in vielen europäischen Ländern mit oft ähnlichen Themen auftritt. Genauer zu recherchieren, welches die aktiven Akteure sind, wäre eine interessante Aufgabe.
Aber an dieser Stelle genügt der Hinweis: Wer ernsthaftes Interesse an direkter Demokratie hat, müsste umgekehrte Prioritäten setzen: Volksabstimmungen statt Bürgerräte! Man müsste dazu noch nicht einmal ein fanatischer Direktdemokrat oder ein Gegner repräsentativer Demokratie sein, sondern nur ein nüchterner Freund des Grundgesetzes. Man könnte sogar fragen, warum kluge Juristen nicht schon längst eine Verfassungsklage gegen den Bundestag erhoben haben wegen Unterlassung der Realisierung eines Grundgesetzauftrages. In Sachen Wahlrechtsreform und zu anderen Themen wird der Bundestag ja auch vom Verfassungsgericht zum gesetzgeberischen Handeln verpflichtet.
Statt dessen schreitet die Bewegung voran, die an Parlamenten und Volksabstimmungen vorbei Politik machen will. Die „Klimaschutz“bewegung fordert nun inzwischen die Einrichtung eines Gesellschaftsrates, um die Klimaziele endlich voranzutreiben, die in der bisherigen Politik nicht radikal genug realisiert wurden. Ein solcher von „Klimaexperten“ einberufene und fachlich betreute „Gesellschaftsrat“ (die Neue Zürcher Zeitung sprach hier von „Betreutem Denken“) soll dann nicht nur Empfehlungen abgeben, sondern sein Wille sei Gesetz. Für diesen offensichtlich diktatorisch motivierten Vorschlag steht sogar das öffentlich-rechtliche Fernsehen propagandistisch zur Verfügung („Hart aber fair“ im Februar 2023).
Wenn es für Volksabstimmungen auf allen Ebenen entsprechend niederschwellige Angebote und inhaltlich umfangreiche Kompetenzen gäbe, bräuchte man sicher keine Vorbereitungsgruppen, die Bürger- oder Gesellschaftsräte zu den Themen einberufen, die der Vorbereitungsgruppe wichtig zu sein scheinen. Die Bürger könnten dann selbst die Initiative ergreifen zu den Themen, die ihnen wichtig zu sein scheinen. Natürlich kann man in den Bürgerräten positiv eine Möglichkeit sehen, politische Diskussionen in der Bürgerschaft zu beleben. Aber die andere Möglichkeit – Volksabstimmungen, und zwar ebenfalls mit offizieller organisatorischer und finanzieller Unterstützung – wäre demokratisch weitaus konsequenter.
Erfolgsmodell Schweiz

Das politische System der Schweiz kann in seiner lebendigen Breite und historischen Tiefe hier natürlich nicht angemessen dargestellt werden. In der Bibliothek gibt es einige Verweise auf mögliche Vertiefungen. Im Folgenden wird nur ein Buch rezensiert, welches sich mit dem Zusammenhang zwischen direkter Demokratie und dem Wirtschaftsleben befasst. Werner Wüthrich: Wirtschaft und direkte Demokratie in der Schweiz, Zürich 2020.
Das Buch umfasst 29 Kapitel in elf thematischen Schwerpunkten, die auch für sich gelesen werden können. Die Teilabschnitte beziehen sich auf verschiedene historische Abschnitte seit der Gründung des Bundesstaates 1848, aber auch auf inhaltlich verschiedene Themen wie Wirtschaftstheorie, Finanzpolitik, Landwirtschaft und andere. Nicht alles kann in einer Rezension angemessen gewürdigt werden.
Die Gründung des Bundesstaates geschah unter den geistigen Einflüssen der Aufklärung und der Französischen Revolution, von wo zum Beispiel die individuellen Freiheitsrechte übernommen wurden. (Der Freiheitsbegriff der alten Eidgenossen war ein anderer, er bezog sich auf die Unabhängigkeit von fremden Mächten). Aus der amerikanischen Verfassung übernahm die Schweiz vor allem das Zweikammersystem (National- und Ständerat). Die eigentliche Basis des Bundesstaates war aber die eigene Geschichte, die seit dem Bundesbrief von 1291 auf der Freiheit und Unabhängigkeit von fremden Feudalherren aufbaute, verbunden mit der gegenseitigen Beistandspflicht und der gelebten direkten Demokratie, vor allem in den Landsgemeinde-Kantonen. Direkte Vorbilder für die Bundesverfassung von 1848 waren eine ganze Reihe kantonaler Verfassungen der Regenerationskantone in den 1830er Jahren, in denen die direkte Demokratie bereits angelegt war. Die souveränen Kantone, die sich zum Bundesstaat zusammenschlossen, behielten eine starke Stellung. Dies führte dazu, dass nach der Gründung des Bundesstaates wie bereits zuvor immer wieder eine Konkurrenz zwischen dezentralen Souveränitätsbestrebungen und zentralisierenden Absichten politisch wirksam wurde. Erstere gingen oft von der Landbevölkerung aus und prägten die direktdemokratischen Instrumente (Referendum, Volksinitiative) zuerst in einigen Kantonen, letztere waren in den Städten stärker und setzten mehr auf das, was wir heute als repräsentative Demokratie bezeichnen. Dieser «Zielkonflikt» ist in verschiedenen Formen bis heute lebendig.
Ein interessantes Beispiel dafür ist das Porträt von Alfred Escher, einem prägenden Politiker und Wirtschaftsführer Mitte des 19. Jahrhunderts. Der Zürcher Unternehmer war 36 Jahre lang im Kantonsrat, 34 Jahre lang im Nationalrat, sieben Jahre lang im Regierungsrat, gründete eine Eisenbahngesellschaft, eine Bank (heute Credit Suisse), eine Hochschule (heute ETH) und vieles mehr. Er war Anhänger der repräsentativen Demokratie und Gegner der sich formierenden Demokratiebewegung für mehr direkte Volksbeteiligung. Aber diese setzte sich in Form einer sehr fortschrittlichen Verfassung für Zürich 1869 durch – ohne deshalb auf die unternehmerischen Initiativen von Escher verzichten zu wollen. Beide Seiten «ergänzten sich im politischen Zusammenspiel und bereiteten den Boden für die Entwicklung der modernen Schweiz» (Seite 61).
Ein anderes Beispiel ist das Funktionieren der Demokratie in den 1930er und 1940er Jahren, als die Schweiz von aggressiven europäischen Diktaturen rings umgeben war. Im Ersten Weltkrieg hatte man schmerzlich gelernt, wie wichtig die Selbstversorgung mit lebenswichtigen Produkten in einem rohstoffarmen und schon damals stark exportorientierten Land ist. Man hatte aus dieser Erfahrung heraus auch mit Hilfe von Volksabstimmungen Regelungen getroffen, wie die eigene Landwirtschaft staatlich zu stützen sei. Das half der Selbstversorgung, während ringsum Nazi-Diktatur und Faschismus herrschten. Ab 1939 übergab das Parlament der Exekutive die Kompetenz, das Land mit Notverordnungen durch die schwierige Zeit zu führen, wozu der Souverän, das Volk, teilweise zugestimmt hatte, weil er verstand, dass rasche Handlungsfähigkeit nötig sei. Nach dem Krieg gab es aber dann Stimmen, zum Beispiel von Zaccaria Giacometti, dem herausragenden Staatsrechtsprofessor an der Universität Zürich, die die Fortführung des Notregimes kritisch sahen und auf der Entscheidungshoheit durch den Souverän bestanden. Diese Stimmen waren wichtig, um nach dem Krieg dafür zu sorgen, dass die Exekutive ihren entstandenen Machtzuwachs nicht als Dauerzustand für zivile Zeiten beanspruchte. Die Volkssouveränität existierte nicht nur auf dem Papier, sie wurde immer wieder wahrgenommen durch wachsame Bürger. Das geschah nicht durch revolutionären Kampf, sondern durch Berufung auf und Wahrnehmung der verbrieften Rechte, die dadurch auch immer wieder der jeweiligen Zeit angepasst wurden.
Der Landwirtschaft ist ein eigener Teil des Buches gewidmet, in dem dargestellt wird, wie über Jahrzehnte hinweg im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts Regelungen geschaffen wurden, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Schutz der bäuerlichen Betriebe und der Nahrungsmittelsicherung sowie dem Natur- und dem Tierschutz ermöglichen. Dazu gab es zahlreiche Volksinitiativen von verschiedenen Interessengruppen, die vom Bundesrat und dem Parlament miteinander koordiniert werden mussten. Manche Initiativen wurden zurückgezogen, wenn Parlamentsvorlagen das Anliegen aufgriffen und dabei auch andere Anliegen sinnvoll mit einbezogen.
Für deutsche und vermutlich auch alle anderen Leser besonders interessant ist die Tatsache, dass die Schweizer auf einen ausgeprägten Föderalismus großen Wert legen. Das ist verständlich, weil die Souveränität hier tatsächlich dezentral funktioniert. Gemeinden und Kantone haben nicht nur eine wesentlich größere finanzielle Autonomie als in anderen Ländern (der Bund finanzierte sich bis zum Ersten Weltkrieg ausschließlich aus Zolleinnahmen und ist heute noch stark von den unteren Ebenen abhängig), sondern der Souverän selbst, die Bürgerschaft, hat die finanzielle Souveränität auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene. Die Bürger entscheiden direkt über die Erhebung und die Verwendung von Steuern per Abstimmung. Deshalb sind sie bereit, vorübergehend auch höhere Steuern zu zahlen, wenn sie wissen, dass diese für den gewünschten Zweck verwendet werden und nicht in dubiosen Kanälen versickern.
Das erklärt auch Abstimmungsergebnisse, die den Ausländer verwundern. So lehnte der Souverän 1973 eine Initiative ab, mit der eine einheitliche Bundessteuer auf Einkommen und Vermögen und Kapitalerträge eingeführt werden sollte – anstelle der bisherigen unterschiedlichen kantonalen Steuern. Die damit gewünschte bundesweite Steuergerechtigkeit wurde von den Bürgern deutlich nicht so hoch eingeschätzt wie die finanzielle Souveränität der Kantone. Dezentralität, also bürgernahe Entscheidungsgewalt, war den Bürgern wichtiger als die Gleichheit der Steuersätze.
Die systematische Darstellung, welche Abstimmungsregelungen es auf den verschiedenen Ebenen gibt, ist nicht Gegenstand des Buches. Man erfährt aber im Zusammenhang mit den verschiedenen Themenschwerpunkten schon, wie es funktioniert, und auch, wie komplex und historisch eingespielt das ist. Fakultative Referenden, um Parlamentsbeschlüsse vors Volk zu bringen, Initiativen, die von Bürgergruppen oder von den politischen Parteien ausgehen, um eigene Gesetzesvorlagen einzubringen, obligatorische Referenden, wenn Änderungen der Bundesverfassung zur Entscheidung anstehen; und dazwischen immer Verhandlungen im Parlament, wenn verschiedene Initiativen, die von den Bürgern direkt oder von einer Partei oder von Kantonen ausgehen, koordiniert und mit anderen Themen abgestimmt werden müssen.
Nicht verschwiegen wird, dass nicht wenige Politiker seit vielen Jahren bestrebt sind, die Schweiz an die EU heran-, wenn nicht in sie hineinzuführen. 1992 gab es eine Volksabstimmung über den Beitritt zum EWR mit klar negativem Ergebnis, obwohl die grossen Parteien, der Bundesrat und das Parlament den Beitritt befürwortet hatten. Das Stimmenverhältnis war zwar knapp, aber die meisten Kantone stimmten dagegen. Seither ist die Schweizerische Volkspartei SVP zur stärksten Partei geworden, unter anderem weil sie klar gegen den EU-Beitritt steht. Die Schweizer Industrie ist stark exportorientiert und international ausgerichtet, aber die Schweiz pflegt ihre wirtschaftlichen Beziehungen mit anderen Ländern nicht durch Souveränitätsabgabe, sondern über bilaterale Verträge. Dank des direktdemokratischen Systems, einer kleinräumigen Wirtschaft und einer vom Volk eingeführten wirksamen Schuldenbremse ist die Schweiz eines der wirtschaftlich erfolgreichsten Länder nicht nur Europas, sondern der Welt, Der Anteil der Industrieproduktion pro Kopf der Bevölkerung ist so hoch wie in fast keinem anderen Land. Die Schweiz lebt also nicht nur von Käse und international gefüllten Bankkonten. Das hohe Maß an Lebensqualität der Bürger ist aus eigener Kraft geschaffen. Bei einer Einbindung der Schweiz in die EU würde sie ihr politisches System der Volkssouveränität im Rahmen eigener parlamentarischer, exekutiver und judikativer Gewaltenteilung weitgehend verlieren. Auch die international wichtige Funktion der Schweiz als neutrales und friedensvermittelndes Land würde verlorengehen.
Soweit einige knappe Worte zu diesem sehr lesenswerten Buch.
Vereinigte Staaten von Europa – ein erstrebenswertes historisches Ziel?
Es gibt noch keine Vereinigten Staaten von Europa, aber sie scheinen seit langem von manchen politischen Akteuren angestrebt zu werden. Dagegen wäre nichts einzuwenden, wenn es sich um vereinigte und nicht um vereinnahmte Staaten handeln würde. Also um weiterhin souveräne Einheiten, die sich zu bestimmten Aufgaben als gleichberechtigte Partner zusammenschließen, so wie das Menschen tun, die sich zu einer Genossenschaft mit einer definierten Aufgabe zusammenschließen. Solche Aufgaben könnten zum Beispiel der Freihandel sein, also die Zollfreiheit zwischen den Staaten oder gemeinsame Prinzipien in der Außen- und Verteidigungspolitik, ggf. mit demokratischer Wahl entsprechender Repräsentanten. Tatsächlich wird das Projekt aber begleitet mit Kampagnen gegen den Nationalstaat, der im Zeitalter der Globalisierung etwas längst Überlebtes und sowieso schon immer Gefährliches sei. Der Zusammenschluss zu größeren staatlichen Einheiten mit fortschreitender Aufgabe nationaler Souveränitäten sei ein notwendiges Projekt für Frieden und wirtschaftlichen Wohlstand und um eine hörbare Stimme in der Welt zu haben. So und ähnlich hören wir es immer wieder.
Unter Kernthemen habe ich im Kapitel Europäische Union bereits erwähnt, dass wirtschaftliche Zusammenarbeit und friedliche Kooperationen möglich sind, ohne dass demokratische Souveränitätsrechte abgegeben werden; die ersten Jahrzehnte der Nachkriegszeit im Rahmen der EWG und auch der EFTA belegen das und der vorbildliche wirtschaftliche Wohlstand zum Beispiel der Schweiz illustriert das bis heute. Tatsächlich wurde und wird das Projekt EWG, EU aus machtpolitischen Motiven betrieben und trägt von Anfang an keine demokratische Handschrift. Deshalb wird im Folgenden ein Einblick in den historischen Prozess gegeben, der als europäische Einigung tatsächlich stattgefunden hat.
Ich verweise hier auf einige interessante Beiträge zur Frühgeschichte dieses Projektes und einen seiner maßgeblichen Akteure – Jean Monnet – sowie auf die politischen Auseinandersetzungen auch um Alternativen, die damals diskutiert und betrieben wurden. Diese fünf Beiträge aus den Jahren 2011 /12 beziehen sich zum Teil zwar auf damals aktuelle Ereignisse, enthalten aber viele historisch wichtige Hintergrundinformationen.
Die demokratische Nation – von der Idee …
Der Aufbau der Europäischen Union hin zu Vereinigten Staaten (?) von Europa, wie sie bereits von Jean Monnet avisiert worden waren, ging immer einher mit einer gegen die Nationen gerichteten Propaganda. Nationen werden gerne mit Nationalismus gleichgesetzt und für Kriege, Ungerechtigkeiten aller Art bis hin zu wirtschaftlichem Niedergang verantwortlich gemacht. Deshalb ist es in diesem Zusammenhang unerlässlich, die Geschichte und die Funktion von Nationen etwas genauer zu betrachten.
Die natio bezeichnete im lateinischen Wortsinn die Geburtsherkunft, nicht unbedingt territorial, sondern vom Volksstamm, von der Verwandtschaft einer Person bestimmt. Ein in Rom geborener Mensch konnte zum Beispiel syrischer oder gallischer Nation (=Herkunft) sein, wenn seine Eltern aus diesen Provinzen stammten. Das hatte weiter keine rechtlichen Folgen; er konnte römischer Bürger sein oder auch nicht; das hing von anderen Dingen ab.
Nationen als Flächenstaaten, gar mit automatisch gleichen Bürgerrechten für die hier dauerhaft lebenden Bürger sind in der Menschheitsgeschichte noch nicht sehr alt – bei genauem Hinsehen gab es sie zu Anfang des 20. Jahrhunderts fast noch nirgends. Flächenstaaten als undemokratische Gebilde gab es schon lange; sie nannten sich früher Königreiche, Herzogtümer etc., es waren Herrschaftsgebiete einer Monarchie oder Oligarchie, die sich nicht als Nationen definierten. Der Begriff Nation ist in der Geschichte vor allem mit der Idee einer republikanischen Gleichheit der Bürger vor dem Gesetz verbunden. Nationale Erhebungen waren im 19. Jahrhundert demokratische Bewegungen gegen mehr oder weniger despotische Herrscherhäuser. Man sollte genau hinschauen, auf welchen Sack man drischt, wenn man den Nationalismus treffen will: Die historischen Negativ-Beispiele für „Nation“ meinen in der Regel Monarchien oder Diktaturen, aber nicht demokratische Republiken. Das Thema „Nationalismus“ als eine gemeingefährliche Geisteshaltung wird weiter unten genauer betrachtet.
Als erste Demokratie wird uns meist das antike Griechenland genannt. Das waren städtische Republiken mit gewählter Führung innerhalb einer Bürgerklasse, die durch Besitz definiert war und selbstverständlich nur für Männer galt – wie das ja in fast allen Republiken bis nach dem 1. Weltkrieg der Fall war. Die Idee einer Nation als territoriale Einheit, deren Grenzen zu schützen sind und die gleichberechtigt neben anderen territorialen Einheiten steht, begegnet uns nach dem Dreißigjährigen Krieg 1648 im Friedenschluss von Münster. Hier ging es noch nicht darum, wie Nationen sich im Innern organisieren sollten sondern darum, dass sie sich nicht mit wechselseitigen Eroberungskriegen überfallen sollten. Das funktionierte zwar nur zeitweise, wie wir wissen, aber es war ein Schritt zum Beginn einer territorial definierten internationalen Rechts- und Friedensordnung, aus der sich später das Völkerrecht als eine Friedensbasis entwickeln konnte.
Welches Recht diese Nationen sich intern geben, wie sie regiert werden, sollte im 17. Jahrhundert von niemandem außerhalb zu bewerten sein – lediglich die Religions- bzw. Konfessionsfreiheit sollte gewährleistet sein. Damals gab es selbstverständlich noch nicht die sonstigen individuellen Bürgerrechte, wie wir sie heute kennen. Die Leibeigenschaft war für viele Menschen trauriger Alltag; ein allgemeines Wahlrecht gab es noch lange nicht. Aber es war ein entscheidender Schritt hin zum Frieden unter den Völkern, hergeleitet aus naturrechtlichen Überlegungen, die ihrerseits auf der christlichen Ideengeschichte und auf der antiken Philosophie fußen. Das war eine Basis für später entstandene mehr oder weniger demokratische Friedens- und Rechtsordnungen, mit Bürgern, nicht Königen als Souveräne. Diese Ideen waren ohne nationale Souveränität nicht denkbar, sondern brauchten diese gerade. Und brauchen sie übrigens bis heute.
Der nächste Schritt war es und ist es bis heute, unsere jeweilige Nation im Innern demokratischer zu gestalten, dafür zu sorgen, dass nicht Eliten mit partikularen Interessen an die Schalthebel der Macht gelangen und sich so verhalten wie das frühere Königshäuser taten. Die breite Mehrheit der Bürger hat nie Interesse an einem Krieg. Krieg folgt auch nicht aus der nationalen Organisationform, sondern aus Eroberungslust von Minderheiten an den Entscheidungshebeln und aus deren fehlendem Respekt vor anderen Nationen. Deshalb ist Demokratie innerhalb der Nation die Prävention gegen Krieg, ganz abgesehen davon, dass sie auch innerhalb der eigenen Grenzen die menschengerechte Lebensform ist. Wer dagegen Grenzen niederreißt, zerstört notwendig auch Rechtsräume. Wo Nationen zu größeren Einheiten zusammengelegt, zentralisiert werden, entstehen (bestenfalls) bürgerfernere Rechtsetzungen. In der Frühgeschichte der USA führte dieses Problem übrigens zu heftigen Diskussionen, wenn neue Staaten im Zuge der Eroberung des Westens aufgenommen werden sollten, weil kluge Köpfe damals schon wussten, dass territoriale Erweiterungen zu einem Verlust an demokratischer Selbstbestimmung führen können.(siehe Jill Lepore_Bibliothek).
… über die Geschichte …
Die Nationen, die nach dem Westfälischen Frieden in Europa entstanden, waren noch keineswegs demokratisch organisiert. Der französische Absolutismus, den andere Nationen gerne nachgeahmt haben, erlebte mit Ludwig XIV. in Versailles erst danach seine Blüte. Das englische Weltreich wurde danach aufgebaut – obwohl England bereits ein Parlament hatte, in dem natürlich nicht alle, aber die besitzenden und adeligen Männer die Macht des Königs beschränken konnten.
Die erste moderne Demokratie waren die USA. Sie konstituierten sich in einer Welt der Monarchien noch vor der Französischen Revolution als Republik mit einer auf Zeit gewählten Legislative und einem auf Zeit gewählten Präsidenten. Damals ein revolutionärer Schritt. Allerdings noch weit entfernt von allgemeinen Bürgerrechten: Frauen dürfen in den Vereinigten Staaten erst seit 1920 zur Wahl gehen. Gleiche Bürgerrechte für die Schwarzen oder die beinahe ausgerotteten und komplett zerstörten First Nations gab es noch nicht einmal auf dem Papier, als der Schreiber dieser Zeilen geboren wurde. In den ersten fast 100 Jahren war die Sklavenhaltung in den USA selbstverständlich; damit fiel diese Republik weit hinter die Standards europäischer Monarchien zurück.
Die Französische Revolution, angeregt auch durch die amerikanische, stand unter dem Zeichen „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“. Brüderlichkeit: Die „Schwestern“ erhielten in der Republik Frankreich erst 1944 das Wahlrecht. Gerne haben manche der Schweiz ihre Rückständigkeit vorgehalten, weil dort die Frauen auf Bundesebene noch einmal 27 Jahre später das Wahlrecht erhielten. Aber damit ist die Schweiz noch nicht einmal das europäische Schlusslicht. In Portugal geschah das erst nach der Nelkenrevolution mit der Verfassung von 1975. Und andere Länder sind nicht meilenweit davon entfernt: England 1928, Spanien 1931, Italien 1946, Belgien 1948, Griechenland 1952. Deutschland und die skandinavischen Länder sind mit der Einführung des Frauenwahlrechts um 1920 schon Veteranen auf diesem Gebiet. Aber selbst in (West-)Deutschland durfte eine Frau ohne die Erlaubnis ihres Ehemannes kein Bankkonto eröffnen und keinen Beruf ausüben – in einer Zeit, als es bereits einen Bundeskanzler Adenauer gab. Andererseits: es gab durch die territoriale Ordnung in Nationen überall definierte Rechtsräume, in denen die Bürger sich diese und andere Rechte erarbeiten, erstreiten konnten. Und das haben sie auch getan.
So konnten Demokratien sich entfalten: innerhalb einer Nation. Hier sind die Regeln des gesellschaftlichen Lebens gewachsen, unter den Menschen mit einer einigermaßen zusammenhängenden Kulturgeschichte, mit Pausen und Rückschlägen zwar, aber was wäre die Alternative? Demokratische Regeln ohne Rücksicht auf Verluste exportieren, wie es die USA und ihre Verbündeten im Irak, in Afghanistan und anderswo – angeblich – getan haben? Ergebnis: zerstörte Zivilisationen. Rückfall in schlimmere Zeiten als zuvor…
Auch das demokratische Musterland Schweiz hat sich schrittweise innerhalb seiner Grenzen entwickelt und ist nicht in ausgereifter Form vom Himmel gefallen. Die dauernde bewaffnete Neutralität wurde auf dem Wiener Kongress 1815 bestätigt, der moderne Bundesstaat wurde 1848 gegründet, 200 Jahre nach dem Westfälischen Frieden. Möglichkeiten zur direkten Einflussnahme des Volkes auf Gesetzgebung und sogar Verfassung sind erst danach in langen politischen Auseinandersetzungen entstanden. Nur so konnten sie gelebter Bestandteil dieser Eidgenossenschaft werden und nur so ist die verhältnismäßig hohe politische Reife und Kultur des Schweizervolkes verständlich, auch wenn dort heute zunehmend Störungen in dieser politischen Kultur zu beobachten sind.
Das Deutsche Reich schließlich wurde als Nation 1871 gegründet – als Kaiserreich mit zunächst rudimentären demokratischen Regeln. Aber immerhin schon mit einem Bürgerlichen Gesetzbuch, welches eine Rechtsordnung auf Basis der Gleichheit der Bürger zumindest im zivilen Leben sichert. Wie hätte das ohne nationale Grenzen, also ohne einen Geltungsbereich des Rechts geschehen können? Und wie sollte das – um einen Blick in Gegenwart und Zukunft zu werfen – ohne nationale Grenzen weiter gelten können? Wollen wir unser BGB anderen Nationen aufzwingen? Oder zugunsten eines „Europäischen Gesetzbuches“ auf den Müllhaufen der Geschichte werfen? Bitte nicht! Was an unseren Gesetzen und an vielem anderen zu ändern wäre, sollte nicht gesetzgebenden EU-Kommissaren überlassen werden, die vielleicht nicht einmal der deutschen Sprache mächtig sind.
Die Idee, Respekt der Nationen voreinander in die Realität umzusetzen, hat Jahrhunderte gedauert und mehr oder weniger schlecht funktioniert. Aber warum? Nicht weil es Nationen waren, sondern weil die Verfassungen der Nationen mangelhaft waren oder nicht konsequent weiterentwickelt wurden, und vor allem: nicht ausreichend aktiv gelebt wurden. Die Nationen waren zu lange Zeit herrschaftlich, monarchisch organisiert. Und auch als sie genossenschaftlicher, demokratischer organisiert waren, dauert(e) es oft Generationen bis die Mehrzahl der Bürger das auch zu leben verstand. Viele verstehen es bis heute nicht, zucken mit den Schultern und gehen ihrer Wege – in einem Gemeinwesen, dessen Gestaltung sie damit anderen überlassen. Was nicht nötig wäre.
Die Nation als territorial definierter Raum ist und bleibt, allen Vorbehalten zum Trotz, der erste Schritt zum Frieden, ihre demokratische innere Ordnung der notwendige zweite. Diese inneren Ordnungen werden aus den kulturellen Traditionen und auch aus deren streitigen Auseinandersetzungen heraus entwickelt und unterscheiden sich deshalb von Land zu Land. Denn es gibt nicht die eine richtige Demokratie, sondern es gibt Rechtsordnungen für das zivile und das politische Leben, die die Menschen unter historischen, geografischen, kulturellen Bedingungen vereinbaren. Diese Rechtsordnungen sind desto mehr Demokratien je mehr Bürger und Bürgerinnen an ihrer Gestaltung beteiligt waren und sind. Indem sie sich selbst daran beteiligen. Dieser Prozess wird niemals einen europäischen oder gar globalen pürierten Eintopf als Resultat haben. Solche Eintöpfe werden immer nur „höheren Orts“ angerührt.
Man kann und muss die demokratische Reife einer Nation übrigens nicht nur an ihrer inneren Ordnung, sondern kann sie auch an ihrer Bereitschaft zum Frieden mit anderen Nationen messen. Dieser Satz enthält Sprengstoff, den wir hier aber nicht zünden wollen.
… in die Zukunft
Denn das Thema ist Europa, die gegenwärtige Europäische Union oder der von politischen Führern angestrebte europäische Einheitsstaat. Wir haben oft gehört, dass ein neues europäisches Haus gebaut werden müsse. Aber wer bestellt den Baumeister, wer ist der Bauherr, und nach welchem Plan geschieht der Umbau? Die EU sieht bereits aus wie ein Staat mit diversen Institutionen und teuren Beamten, sie handelt wie ein Staat mit Rechtsetzungsakten und Staatsverträgen, aber es gibt kein Staatsvolk. Kein demokratischer Souverän, kein Bürger der beteiligten Nationen ist gefragt worden, ob er Teil eines übergreifenden Staates werden will. Dort, wo es im Nachhinein Volksabstimmungen zu einer europäischen Verfassung gegeben hat, waren die Ergebnisse enttäuschend für die Verfechter der EU – sie haben die Verfassung deshalb beiseitegelegt und durch einen nahezu identischen Staatsvertrag („Lissabon“) ersetzt.
Die EU hat kein Parlament als Legislative. Das Europäische Parlament ist keine gesetzgebende Versammlung – auch wenn seine Befürworter gerne betonen, dass es „jetzt schon mehr“ Rechte habe als früher. Tatsächlich erfolgt die Gesetzgebung über EU-Richtlinien, die von der EU-Kommission erlassen und dann in den nationalen Parlamenten umgesetzt werden. Um diesem Tatbestand einen demokratischen Anstrich zu geben, wurde im Jahre 1992 unser Grundgesetz geändert, namentlich Artikel 23:
Im neuen Artikel 23 wurden die Souveränitätsabgabe und die Auflösung der nationalen Legislative (!) zugunsten einer suprastaatlichen Exekutive festgelegt. Dort heißt es: „Die Bundesregierung gibt dem Bundestag Gelegenheit zur Stellungnahme vor ihrer Mitwirkung an Rechtsetzungsakten der Europäischen Union.“ Weiter wird ausgeführt, dass die Bundesregierung diese Stellungnahme, bzw. soweit die Gesetzgebungshoheit der Bundesländer betroffen ist, auch die Stellungnahme des Bundesrates, berücksichtigt. Mit anderen Worten: Die Rechtsetzung, das Legislativrecht, geschieht durch die Europäische Union, konkret durch die Kommission und ihre Organe, die Bundesregierung wirkt daran mit und sie berücksichtigt bei ihrer Mitwirkung die Stellungnahmen unserer Legislative, im Fall der Bundesländer nicht einmal die von deren Legislativen, sondern die der Länderregierungen (denn diese bilden den Bundesrat). Was „Mitwirkung“ und „Berücksichtigung“ heißt, kann man nicht nachlesen, aber man kann es sich denken: nichts Verbindliches.
Damit ist unser gewaltenteiliges föderales Gesetzgebungssystem quasi im Vorübergehen abgeschafft worden. Es geht aber noch weiter: Dazu passend hatte man bereits 1990 auch die Präambel des Grundgesetzes geändert. Früher hieß es dort: „… von dem Willen beseelt, seine nationale und staatliche Einheit zu wahren und als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen…“. Der Passus „seine nationale und staatliche Einheit zu wahren und“ wurde gestrichen. Unsere Parlamentarier haben damit deutlich kundgetan, dass sie die nationale und staatliche Einheit Deutschlands nach der Wiedervereinigung nicht mehr wahren wollen. Gewaltenteilung und Volkssouveränität gehören nicht mehr zu diesem Projekt. Das gibt nur Sinn, wenn man einen Wirtschaftsraum anstrebt, der möglichst ohne politische Prozesse im Sinne öffentlicher Meinungsbildung und demokratischer Entscheidung funktioniert, der ein öffentliches Leben im bürgerlich-demokratischen Sinn also gar nicht mehr braucht. Das ist die Idee einer großen europäischen Firma, in der die alten politischen Systeme nur noch im Sinne von Verwaltungsapparaten zur Durchsetzung zentraler Entscheidungen missbraucht werden. Mit einem mächtigen und absolutistisch organisierten Vorstand, der unter dem Arbeitstitel „Europäischer Stabilitätsmechanismus“ installiert wurde und dem laufend neue Strukturen in diesem Sinne beigeordnet werden.
Wer sich diesem antinationalen Projekt anschließt, weil er Nation für veraltet hält, der muss ehrlicherweise auch zugeben, dass er Demokratie für veraltet hält.
Eine Rezension
Einen guten Überblick über Geschichte und Struktur der Europäischen Union gibt Hannes Hofbauer in seinem Buch „Europa – ein Nachruf“ (Wien 2020). Ich habe für die „Nachdenkseiten“ eine Rezension dazu verfasst, die ich im Folgenden zitiere:
Rückblick und Start
Die vom griechischen Gott entführte und geschwängerte phönizische Königstochter „Europa“ bildet – wie könnte es anders sein? – den Anfang auch in Hofbauers Buch. Der historische Rückblick geht weiter über die von den Griechen gewählte Unterscheidung der damals bekannten Welt in „Europa, Asia, Libya“. Aber schon damals war unklar, wo genau die Grenze zwischen Europa und Asia verlaufe. Erst im 18. Jahrhundert definierte man das ungefähr geografisch.
Interessant ist die vielfach illustrierte Darstellung, dass Europa nie als politische oder kulturelle Einheit aufgetreten ist; stattdessen gab es zu verschiedenen Zeiten verschiedene Definitionen, was als „nicht-europäisch galt: Barbaren, Heiden, orthodoxe Christen, Muslime, Kommunisten, Nationalisten etc.“ (S.12). Immer wieder wurde eine europäische Idee beschworen oder nachträglich in die Geschichte projiziert, die tatsächlich aber jeweils nur begrenzten politischen Zielen entsprang. Zum Beispiel wurde der Namensgeber des europäischen „Karlspreises“ vor 1.200 Jahren vom Papst zum Kaiser gekrönt, weil er als Gegengewicht zum byzantinischen Kaiser (auch ein „Europäer“!) gebraucht wurde. Seine nachfolgenden Eroberungszüge hatten nichts mit einer friedlichen europäischen Vision zu tun. Auch während der Kreuzzüge war das christliche Abendland keine Einheit z.B. gegen die muslimischen Heiden, sondern konfessionell-machtpolitisch zerstritten. Ebenso waren nach der Reformation die ärgsten Feinde von Christen andere Christen. Und so weiter.
Vielleicht erstmals hat Leibniz Ende des 17. Jahrhunderts eine europäisch-christliche Einheit unter Einschluss des orthodoxen Russlands beschworen -allerdings im Sinne einer starken Macht zur „Zivilisierung“ anderer Kontinente (S. 28 f)! Ein Jahrhundert später trat Napoleon Bonaparte als gewalttätiger Vollstrecker solcher Gedanken auf, wenn auch nicht mit, sondern gegen Russland. Er wollte überall nicht nur gleiches Recht, sondern dadurch sogar ein einheitliches Volk schaffen (S. 32). Friedlichere Ideen und Taten sind mit Namen wie Erasmus von Rotterdam oder William Penn verbunden; letzterem schwebte bereits um 1700 ein friedliches und republikanisches (!) Europa vor. In dieser Tradition sieht Hofbauer dann Denker wie Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Victor Hugo und andere.
Im 20. Jahrhundert entwarf der französische Politiker Aristide Briand zur Zeit des Völkerbundes ein Europakonzept „auf der Grundlage des Gedankens der Einigung, nicht der Einheit“ (S. 50). Aber das Heft des Handelns lag bei den Nationalsozialisten, die einen Europäischen Staatenbund unter ihrer „arischen“ Führung anstrebten. Der NS-Außenminister Ribbentrop beschrieb eine „Europäische Wirtschaftsgemeinschaft“, in der Hofbauer bereits die europäische Nachkriegsordnung erkennt (S. 57). Dazu verweist er auf die nahtlosen persönlichen Karrieren von Hermann Josef Abs, Karl Blessing und Walter Hallstein. Hinzu kamen nach dem Krieg allerdings die US-amerikanischen Interessen, die Europa unter anderem als Absatzmarkt für ihre im Krieg hochgefahrenen Produktionskapazitäten brauchten. Als maßgeblicher Netzwerker tritt jetzt Jean Monnet auf, ein französischer Weinbrand-Unternehmer, der auch in USA geschäftlich unterwegs war und abseits politischer Mandate viele Verbindungen knüpfte. Als sein politisches „Sprachrohr“ fungierte Robert Schumann, französischer Ministerpräsident und Außenminister.
Neben den rein wirtschaftlichen Interessen ging es „den Gründervätern im Wesentlichen um drei Dinge: die Herstellung einer dauerhaften deutsch-französischen Achse…, den Kampf gegen die kommunistische Sowjetunion…, die Unterstellung dieser beiden Ziele unter ein US-geführtes transatlantisches Kommando“ (S. 71). Erste Schritte der Integration geschahen in der Montan-Industrie. Hier wurden 1949 Strukturen geschaffen, die selbständige nationale Entscheidungen verunmöglichten. Das Alternativkonzept der CDU-Politiker Karl Arnold (Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen) und Jakob Kaiser, die Schlüsselindustrien zu verstaatlichen und genossenschaftlich zu verwalten, hatte keine Chance, da die Fäden in Washington gezogen wurden (S. 86). Auch die Sozialdemokraten und Gewerkschaften schwenkten auf diese Linie ein, da sie sich Mitbestimmungsrechte in der supranational gesteuerten Montanindustrie erhofften.
Die 1955 gegründete EWG übernahm die undemokratischen Strukturen aus der Montanunion. Es handelt sich von Anfang an um ein exekutives „Steuerungssystem mit eigenständigen Hoheitsrechten, das die nationalen Steuerungssysteme überlagert.“ (S. 96) Beinahe zeitgleich wurde 1957 die Europäische Atomgemeinschaft gegründet – vor allem um das Gesamtprojekt der Atommacht Frankreich und den souveräner gesinnten Gaullisten schmackhaft zu machen. Wesentliches Projekt der EWG und dann der EU war und ist die Landwirtschaft, deren Ziel und Ergebnis die Vernichtung der kleinen und Förderung der großen landwirtschaftlichen Betriebe ist.
Politische Entrechtung
1987 trat die „Einheitliche Europäische Akte“ in Kraft, mit der ein großer Schritt der damals 12 Mitgliedsstaaten in Richtung Binnenmarkt getan wurde. Gleichzeitig wurden das Vetorecht einzelner Staaten aufgehoben und „qualifizierte“ Mehrheitsentscheide eingeführt. Es ging um die vier Verkehrsfreiheiten für Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital. Sie wurden in zeitlich gestaffelten Schritten durchgesetzt. Hofbauer stellt dar und illustriert mit Beispielen, dass damit zugleich und wohl bewusst soziale Standards einzelner Länder heruntergefahren wurden.
Als bald danach die Deutsche Einheit auf der Tagesordnung stand, waren es wieder die USA, die dafür sorgten, dass diese gegen den Widerstand von Frankreich und UK durchgesetzt wurde. Nun hoben die Staats- und Regierungschefs in Maastricht die „Europäische Union“ aus der Taufe. Am selben Tag (!) 09.12.91 wurde in Weißrussland unter Führung von Boris Jelzin die Sowjetunion aufgelöst…
Hofbauer erläutert in einem Exkurs die Organe der EU: sie haben nichts mehr damit zu tun, was wir in der Schule über demokratische Souveränität gelernt haben. Der „Rat“, auch Ministerrat genannt, besteht aus Regierungschefs und Fachministern. Seine Beschlüsse gelten, wenn 55 % der Mitgliedsstaaten, die 65 % der EU-Bevölkerung vertreten, sich einig sind (S. 158). Damit können heute 15 Staaten Beschlüsse für 27 Mitgliedsstaaten fassen. Kein weiteres Organ kontrolliert diesen Rat – und schon gar nicht die in Brüssel registrierten und auf den Rat einwirkenden 11.900 Lobbyorganisationen.
Die „Kommission“ besteht in der heutigen Form seit 1967 und verfügt aktuell über 32.000 Bedienstete. Sie allein hat das Initiativrecht im Gesetzgebungsverfahren der EU. Sie ist in ihrem Handeln keinem Parlament verantwortlich oder davon abhängig. Die Präsidentschaft wird im Wesentlichen vom deutschen Kanzler und französischen Präsidenten ausgehandelt; der EU-Präsident ernennt dann die Kommissare – aus jedem Land einen.
Ein „Parlament“ bestand bereits zu Zeiten der Montanunion. Die Parlamentarier wurden bis 1979 von den Länderregierungen ernannt. Seitdem wird das Parlament „direkt gewählt“, allerdings ohne ein länderübergreifend einheitliches Wahlsystem. Es hat kein Initiativrecht zur Gesetzgebung, sondern beratende und bestätigende Funktionen für anderswo getroffene Entscheidungen.
Auch der „Europäische Gerichtshof“ ist schon 1952 gegründet worden, damals „zur Beilegung von Streitigkeiten innerhalb der Gemeinschaft für Kohle und Stahl“ (S. 169). Heute ist er zu einer mächtigen Institution avanciert, der den Vorrang von EU-Recht gegen evtl. widersprechende nationale Rechte durchsetzt. Jedes Land entsendet einen Richter an diesen Hof. In der Sache werden in den Gerichtsverfahren die großräumig produzierenden Industrien gegenüber den kleinräumig Gewerbe Treibenden bevorzugt und „Sozialdumping“-Maßnahmen unterstützt. Hofbauer erläutert das überzeugend mit Beispielen. Wirtschaftlich profitiert vor allem die konkurrenzfähige deutsche Wirtschaft, nicht nur, aber vor allem zu Lasten der neuen Ost-Mitglieder, deren qualifizierte Arbeitskräfte auswandern, dort also fehlen und anderswo die Löhne drücken.
Schließlich wird der „Europäische Rat“ vorgestellt, ein informelles Gremium, das Helmut Schmidt und Giscard d´Estaing 1974 ins Leben gerufen haben. Hier treffen sich viermal im Jahr die Staats- und Regierungschefs, um ohne jede sonstige Legitimation oder Kontrolle Richtlinien zu vereinbaren und Beschlüsse zu fassen.
Der Versuch, die EU-Staatsbildung durch eine Verfassung zu „legitimieren“, misslang als die von Giscard d´Estaing ausgearbeitete Verfassung 2005 bei Volksabstimmungen in Frankreich und in den Niederlanden durchfiel. Allerdings wurde dann 2007 der Vertrag von Lissabon geschlossen, der inhaltlich weitgehend mit der „Verfassung“ identisch war und den EU-Vertrag entsprechend änderte. Seitdem sind die oben genannten Mehrheitsentscheidungen über nationale Souveränitäten hinweg legalisiert. Nationale Handelsverträge zu den vier Verkehrsfreiheiten darf es nicht geben.
Weitere wichtige Themen
Hofbauer schildert ausführlicher die einzelnen Schritte bei der Erweiterung um neue Mitglieder, auch den Brexit, sowie die Bestrebungen zur Militarisierung. Letzteres ist insofern interessant als bereits 1952 ein Vertrag zu einer Europäischen Verteidigungsgemeinschaft von den damals 6 Mitgliedern unterzeichnet wurde, der aber wegen des französischen Widerstands jahrzehntelang Makulatur blieb. Im Zuge des Angriffskrieges gegen Jugoslawien wurde dann aber eine „Europäische Sicherheitsstrategie“ verabschiedet, die ein gemeinsames Corps von Waffenträgern, Kampftruppen und ein Einsatzgebiet von 4.000 km um Brüssel vorsieht – also einen Radius bis Westsibirien, den Aralsee, Teheran, Kuweit, Timbuktu. „Großmachtdenken und die Vision militärischer Schlagkraft bilden seit dem Gipfel von Amsterdam 1997 die Grundlage vieler programmatischer Reden von EU-Granden.“ (S. 146) Auch der Brexit habe eine von der NATO unabhängigere Militarisierung der EU, vor allem durch Frankreich, vorangetrieben; UK sei hier wesentlich NATO-affiner gewesen.
Als Feinde der EU werden nicht etwa die Staaten gesehen, denen es an politischen Freiheiten fehlt, sondern die, denen es an Zustimmung zum freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Arbeitskräften und Kapital fehlt. Dieser ungehinderte Verkehr ist das Kriterium für die Unterscheidung in Freund oder Feind. Dabei kann selbst ein US-Präsident zum Gegner werden, auch wenn er zwar das kapitalistische Eigentumsrecht, aber nicht diesen ungehinderten grenzüberschreitenden Verkehr gutheißt. Hauptgegner ist auch, wie schon seit dem 19. Jahrhundert, Russland sowie neuerdings zunehmend auch China (S. 234 f). Inwieweit hier rein wirtschaftliche oder mehr auch geostrategische Gründe eine Rolle spielen, bleibt im Rahmen dieses Buches offen.
Ausblick und Einwände
Am Ende verlässt Hofbauer die historische und zeitgeschichtliche Darstellung, um mehr persönlich geprägte Beobachtungen und Bewertungen zu geben. Ausgangspunkt ist die Corona-Pandemie, die er als Beispiel für das Versagen supranationaler Steuerung sieht; jede Nation habe hier eigenmächtig und unkoordiniert gehandelt. Nur der freie Kapitalverkehr sei nirgends angetastet worden, der freie Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Arbeitskräften sei aber massiv außer Kraft gesetzt worden (S. 246). Dadurch hätten kleinere Unternehmen gelitten, aber die kapitalstarken Unternehmen seien als Gewinner aus der Krise hervorgegangen. Auch die auf EU-Ebene beschlossenen finanziellen Corona-Unterstützungsmaßnahmen in Milliardenhöhe kämen wieder einmal nur den starken Ländern, nicht den schwachen zugute (S. 253). Soweit, so klar.
Dann verlässt der Autor aber sein Thema und schließt sich den Kritikern an den „autoritären Maßnahmen“ gegen die Covid-Ausbreitung an. Er empört sich über „Attacken“ auf „Demokratischer Widerstand“ und „Querdenken 711“. Die Pandemie, die er als Gefahr kleinredet, ist ihm nur ein (schlechtes) Beispiel für Kritik an nationalen Alleingängen. Nachdem das ganze Buch vorher eine überzeugende Kritik an undemokratischer Supranationalität war, bleibt dieser gedankliche Salto unverständlich. Hofbauer scheint sich auch der Kritik von Jean-Claude Juncker am jüngsten Spruch des Bundesverfassungsgerichtes gegen den EuGH anzuschließen: denn dieser „öffnet die Schleusen für die nationalen Begehrlichkeiten anderer Staaten“ (S. 256). Nationale „Begehrlichkeiten“ sind Hofbauers Sache nicht.
In seiner Vorstellung von einem besseren Europa ist die EU eine verzichtbare Konstruktion; er plädiert für den regionalen, sozialen und ökologischen Schutz vor global agierender Profitmaximierung und Konkurrenzfähigkeit. Auch schrankenlose Mobilität sei nicht erforderlich, da Mobilität immer nur aus einem Mangel am Ort resultiere; dieser müsse überwunden werden. Ein Neuaufbau müsse von unten ausgehen, „lokal vor regional vor national vor international/ zwischenstaatlich“ (S. 260). Diesen Gedanken kann man als Demokrat gut folgen.
Unklar bleibt dem Rezensenten allerdings, in welchen politischen Strukturen der juristische Schutz eines so verstandenen Europas organisiert werden soll. Welcher Souverän macht auf welcher Ebene die Gesetze und sorgt für ihre Durchsetzung – wenn nicht die Bürger der Nationen, die wieder ihre Souveränität auf ihre gewaltengeteilten staatlichen Ebenen zurückholen und mit den anderen Nationen kooperieren müssen? Davor scheint der Autor zurückzuschrecken. Das riecht ihm wohl zu sehr, aber sicher zu Unrecht, nach bösem Nationalismus. Aber wo und wie sonst als in souveränen Nationen kann es Demokratie und Rechtsstaatlichkeit geben? Hofbauers EU-Darstellung untermauert diesen Schluss, den er selbst aber nicht ziehen will.
Kurz: die Alternative zum undemokratischen Zentralismus ist der demokratische Föderalismus. Die Souveränität der Nationen und ihrer möglichst selbständigen Teile sind kein Widerspruch zu Frieden und Wohlstand, sondern deren Garant – zumindest ist dies die Erfahrung der europäischen Geschichte. Dass Nationen auch Kriege geführt haben, widerspricht dem nicht; Krieg zu führen ist kein „Alleinstellungsmerkmal“ der Nation, sondern eines von expansiver Machtpolitik. Diese wird übrigens weniger von kleineren, sondern meist eher großen staatlichen Einheiten praktiziert, einzelne Kantone sind in der Regel weniger aggressiv als große Staaten oder Verbündete – entscheidend ist der Wille und die Möglichkeit einer „Elite“ zu expansiver Machtpolitik. Je größer eine staatliche Einheit, desto schwerer ist der Wille von machtbeflissenen Entscheidungsträgern durch das in der Regel friedfertige Volk zu kontrollieren. Machtpolitik mit Krieg als einem Mittel ist fast immer das Projekt von Minderheiten mit zu viel Machtbefugnis. Inzwischen finden gerade auch durch die bereits mehr oder weniger vereinnahmten Staaten von Europa Kriegsbeteiligungen statt, wie es sie bei den selbständigeren europäischen Staaten der 1950er bis 1980er Jahre nicht gegeben hatte. Und auch andere Großmächte, vor allem Großmächte, sind kriegsaktiv. Bleiben wir also lieber dezentral souverän. Friedlich.
Demokratie als Erziehungsdiktatur?
Ein Beispiel für eine auch heute noch weiterlebende antidemokratische Elitetheorie marxistischer Prägung bietet Prof. Mausfeld in seinen Büchern (Das Schweigen der Lämmer etc.) und in einem Interview, welches hier genauer beleuchtet wird.
https://www.heise.de/tp/features/Wir-leben-in-einer-Zeit-der-Gegenaufklaerung-4178715.html?seite=all
Es ist letztlich ein Werben um Verständnis für eine Erziehungsdiktatur, ohne die niemals ein Fortschritt zu erwarten sei. Diese Denkweise ist in unterschiedlichen Gewändern weiter verbreitet als man glauben möchte. Sie findet sich zwischen den Zeilen auf manch einer „alternativen“ Homepage und in den Köpfen mancher Protestbewegungen. Auch den mehr oder weniger radikalen Klimaschützern ist solches Denken nicht fremd und generell manch einem Bürger, der im Zweifelsfall nicht auf demokratische Entscheidungen warten will. Die folgende Analyse eines Interviews ist insoweit nur Beispiel für andere Elitetheorien.
Im ersten Drittel des Interviews mit Prof. Mausfeld werden recht verschwurbelte Ausführungen über Ideologie und Erkenntnismöglichkeiten ausgebreitet, auf die ich hier nicht eingehe. Sie bekommen gegen Ende aber eine gewisse Funktion im ganzen Argumentationsgefüge. Dann heißt es:
„Auch die Ideologie, dass die repräsentative Demokratie die beste oder zumindest einzig realisierbare Verkörperung der demokratischen Leitidee sei oder, genauer, dass sie überhaupt demokratische Intentionen verkörpere, gehört zu den nahezu unsichtbaren Kernideologien unserer kapitalistischen Elitedemokratien.„
Will wohl sagen: unsere grundgesetzlich basierte Demokratie ist in Wahrheit von Anfang an gar keine. Alles nur Illusion, bzw. „Ideologie“, was im marxistischen Sprachgebrauch ziemlich dasselbe ist. Eine marxistische Grundbildung kann für das Verständnis des Interviews übrigens von Vorteil sein. Es folgen auf den ersten Blick einige schöne Gedanken zur Demokratie:
„Es geht im Grunde um die Frage, warum eigentlich Demokratie erstrebenswert sein soll. Die Leitidee der Demokratie resultiert ja nicht nur aus unserem natürlichen menschlichen Freiheitsbedürfnis, also dem Bedürfnis, nicht dem Willen anderer unterworfen zu sein. Die Leitidee der Demokratie resultiert wesentlich aus dem Wunsch, angesichts der unermesslichen Blutspuren der menschlichen Zivilisationsgeschichte Wege zur Sicherung des inneren und äußeren Friedens zu finden – also konsensfähige zivilisatorische Schutzbalken gegen eine Herrschaft der Gewalt. Durch solche Schutzbalken soll verhindert werden, dass das Gesetz des Stärkeren gilt und der Starke über den Schwachen herrschen kann. Es ging in der Aufklärung wesentlich auch darum, Wege zur Einhegung von Macht- und Gewaltverhältnissen zu finden.
Nun ist in einer durch Pluralität gekennzeichneten Gesellschaft die Heterogenität gesellschaftlicher Interessen so groß, dass es nicht einfach ist, sich auf ein prozedurales Prinzip zu einigen, durch das sich eine Herrschaft nach dem Gesetz des Stärkeren verhindern lässt. Ein solches Prinzip muss so beschaffen sein, dass es den Starken nicht mehr oder andere Rechte einräumt als den Schwachen. Es muss also ein egalitäres Prinzip sein. Die Aufklärung sah ein solches Prinzip darin, dass sich hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Rechte alle Menschen, ungeachtet ihrer faktischen Differenzen, als Freie und Gleiche anerkennen.
Daraus ergibt sich dann alles Weitere: Ein solches egalitäres Prinzip führt innerstaatlich zur Leitidee von Demokratie und zwischenstaatlich zur Leitidee des Völkerrechts. Es unterbindet insbesondere alle Versuche, Macht- und Gewaltbeziehungen auf rassistischen, nationalistischen oder exzeptionalistischen Prämissen zu begründen. Daher wurde es von Beginn an massiv bekämpft, das ist gerade der Kern der Gegenaufklärung.„
Soweit, so gut. Aber dann heißt es weiter unten:
„Aus Sicht der Herrschenden diente die Demokratie fast immer lediglich zur Revolutionsprophylaxe. Auch ist es ein historisches Faktum, dass die Einführung der repräsentativen Demokratie historisch der Demokratieabwehr diente. Dieses Faktum ist in der Fachliteratur unter einer Vielzahl von Analyseperspektiven ausgiebig belegt. Im Buch nenne ich einige relevante Literatur hierzu. Der renommierte Harvard-Rechtshistoriker Michael J. Klarman hat jüngst in seinem Buch „The Framers‘ Coup“ noch einmal in akribischer Detailfülle aufgezeigt, dass die US-amerikanische Verfassung von 1787 aus heftigen Kämpfen zwischen unterschiedlichen Elitegruppierungen hervorging und von einem erkennbar antidemokratischen Geist geprägt ist. Die Einführung der repräsentativen Demokratie diente von Beginn an der Sicherung der Eigentumsordnung und der Erzeugung einer Illusion von Demokratie durch Etablierung einer Elitendemokratie. Diese Ideologie einer Elitendemokratie durchzieht als Mittel einer Demokratieverhinderung das gesamte vergangene Jahrhundert bis heute.„
Immerhin dürfen in Deutschland seit 100 Jahren alle BürgerInnen gleichberechtigt wählen und auf kommunaler und Landesebene auch direkt über Sachfragen abstimmen – darum beneidet uns ein Großteil der Menschheit. Diese Rechte sind als demokratische Errungenschaften aber offenbar nicht weiter der Rede wert.
Im Folgenden wird statt dessen die Verstaatlichung des Wirtschaftslebens als notwendige Basis für Demokratie gefordert. Oder wie soll man diesen Satz sonst verstehen?
„Solange zentrale Bereiche einer Gesellschaft, und dazu gehören insbesondere die Wirtschaft und die Medien, einer demokratischen Kontrolle entzogen sind, kann es keinen unverzerrten und allen gleichermaßen offenstehenden öffentlichen Debattenraum geben, womit dann insgesamt die Bedingung der Möglichkeit von Demokratie entfallen ist.„
Immerhin ist unser Wirtschaftsleben demokratischen Gesetzen unterworfen und auch die Medien sind demokratisch kontrolliert, bzw. wichtige Rundfunk- und Fernsehanstalten gehören sogar der Öffentlichkeit. Ja, darin handelnde Menschen sind oftmals korrumpiert und lassen sich fremdsteuern. (Dass es eine vielfältigere Presse gibt als nur den „Mainstream“, anders als in echten Diktaturen, passt nicht ins Bild und bleibt unerwähnt.) Denn Mausfeld meint mehr als die Möglichkeiten einer „formalen“ Kontrolle: Ihn stört (siehe sein Beitrag im Buch Fassadendemokratie und Tiefer Staat), dass das Wirtschaftsleben überhaupt über Privateigentum organisiert ist. Angeblich herrschen die wenigen großen Privateigentümer mithilfe der „Elitedemokratie“ über die Masse der wenig Besitzenden. Wie eine Nichtelite-Demokratie die Wirtschaft anders als bisher demokratisieren könnte, bleibt Mausfelds Geheimnis. Solange das Geheimnis nicht gelüftet wird, kann man sich darunter nur eine Art Staatssozialismus mit zentraler Planwirtschaft und einer konsequenten Trennung von persönlicher Leistung und persönlichem Erfolg vorstellen, kontrolliert von Staats- oder Parteibeamten. Die Ergebnisse sind aus historischen Experimenten bekannt. Dann heißt es:
„Politik ist in kapitalistischen Demokratien eben nur der Spielraum, den die Wirtschaft ihr lässt.„
Mit „Wirtschaft“ ist hier, das ergibt sich aus dem Kontext, der Kapitalismus als Ganzes gemeint. Echte Demokratie ist im Kapitalismus (also in unserer Wirtschaftsordnung) demnach nicht möglich. Echte Demokratie ist strukturell erst jenseits des Kapitalismus möglich. Was heißt das für aktuelle politischen Aktivitäten? Dass sie mehr oder weniger sinnlos sind. Zuerst muss der Kapitalismus weg. Solche Gedanken kenne ich noch gut aus den K-Gruppen in den 70er Jahren. Im Folgenden wird spekuliert:
„In Zeiten, in denen der Kapitalismus ein gewisses Ausmaß an Demokratisierung als Motor der Produktivitätsentwicklung zugelassen hat, war auch der öffentliche Debattenraum weniger verzerrt und spiegelte ein größeres Spektrum gesellschaftlicher Interessen wider. Die Vorteile, die der Kapitalismus im nationalen Rahmen in der sozialen Pazifizierungsfunktion demokratischer Elemente sah, entfallen jedoch im globalisierten Kapitalismus. Damit ist es nicht einmal mehr wichtig, die Illusion einer Demokratie aufrecht zu erhalten, so dass der öffentliche Debattenraum nun so eingeschränkt wird, wie es für die Stabilität der herrschenden Machtordnung als erforderlich angesehen wird.„
Also: früher mussten die wirtschaftlich Mächtigen sich die Mühe machen, ein Demokratie-Kasperletheater aufzubauen, aber in Zeiten der Globalisierung können sie selbst das bleiben lassen. Eine Begründung, warum das demokratische Mäntelchen früher nötig war, heute aber nicht mehr, erfährt man aus diesem belehrenden Vortrag nicht. Statt dessen wird man weiter belehrt:
„Was sich geändert hat, ist das weitgehende Verschwinden des kritischen Intellektuellen aus dem öffentlichen Raum. Das hängt wiederum mit der neoliberalen Ideologie der Alternativlosigkeit zusammen und mit dem Verlust emanzipatorischer Utopien, wie sie zuvor seit je die Zivilisationsentwicklung angetrieben und geleitet haben.
Damit fehlen uns auch die intellektuellen Vermittler, die all das an uns tradieren, was in mühsamen Prozessen an emanzipatorischen Einsichten und Erfahrungen kollektiv gewonnen werden konnte. Dazu gehören die theoretischen Ideen, auf deren Basis sich politische Erfahrungen ordnen und politische Ziele formulieren lassen. Dazu gehört ein großer Werkzeugkasten ideologiekritischer Denkmethodologie und politisch wirkungsvoller Handlungsstrategien.„

In diesen Werkzeugkasten „ideologiekritischer Denkmethodologie“ hätte man als Leser gerne mal Einblick. Er wird aber nicht geöffnet. So klingt das dann wie die Sehnsucht nach einer klugen Partei, die bekanntlich immer recht hatte. Dazu passt dann:
„Wenn uns hierzu die öffentlichen Intellektuellen als Vermittler fehlen, sind wir von allen emanzipatorischen Traditionen getrennt.„
Das stimmt natürlich nur dann, wenn man das Volk, die normalen Bürger allein, als nicht einsichtsfähig genug betrachtet. Hier wird also eine Intellektuellenclique als zwingend notwendige Führungsgruppe für den Fortschritt behauptet. Dann heißt es folgerichtig:
„Die sozialen Errungenschaften unserer Zivilisationsgeschichte wurden stets von nur wenigen erkämpft, oft gegen den massiven Widerstand der an einer Status quo-Wahrung interessierten Teile der Bevölkerung.„
Diese Behauptung hätte man gerne historisch belegt. So sicher es Beispiele für den Erfolg durch das Engagement Weniger geben mag, so sicher gibt es auch Beispiele für den Fortschritt durch breite Widerstandsbewegungen. Dem Prof. ist es offenbar wichtig zu sagen, dass wir auch heute diese ideologiekritischen Vorbilder brauchen…
„Hier finden wir die Vorbilder, die uns Mut und Hoffnung machen können, dass dies auch in der Gegenwart und in der Zukunft den Erhalt und die Weiterführung emanzipatorischer Fortschritte ermöglicht. Auch in der Gegenwart finden sich in den vielen sozialen Bewegungen in aller Welt, die für diese Ziele kämpfen, genügend Beispiele und Vorbilder, die Hoffnung und Mut machen.„
Aber dann folgt die Einschränkung, die uns wieder zur Elite zurückführen wird:
„In jedem Fall müssen aber Hoffnung und Veränderungswille an ein hinreichendes Verständnis der konkreten Machtstrukturen angebunden sein, die emanzipatorische Fortschritte zu verhindern und rückgängig zu machen suchen.„
Also, nur die Führungspersönlichkeiten sind wichtig, die den großen gesellschaftlichen Durchblick haben. Das erinnert doch sehr an das Kommunistische Manifest 1848. Hier war es der Bund der Kommunisten, der den anderen (damals: dem Proletariat) „die Einsicht in die Gesetzmäßigkeiten und den Gang der Geschichte voraus“ hatte und deshalb zur Führung bestimmt war. Früher hieß das „wissenschaftlicher Sozialismus“, über den diese Führer verfügen mussten; Mausfeld nennt es „ein hinreichendes Verständnis der konkreten Machtstrukturen“, welches die zur Zeit leider fehlenden führenden Intellektuellen haben müssen. Denn die normalen Menschen selbst kommen – gut marxistisch gedacht – nur als soziologisches Detail des Wirtschaftslebens vor, aber nicht als psychologisch geprägte und selbständig denkende Individuen:
„Dass viele Menschen kaum noch etwas ernst nehmen, am wenigsten sich selbst, ist eine ebenso wichtige wie traurige Beobachtung.
Damit hat er (der moderne Mensch)auch vergessen, was es eigentlich heißt, eine Sache oder sich selbst ernst zu nehmen. Sein Ernstnehmen bezieht sich auf Konsumentscheidungen und auf die Optimierung seiner Selbstpräsentation in den sogenannten sozialen Medien.
Einen Traum von Demokratie, wie überhaupt zivilisatorische Träume, hat der „flexible Mensch“ des Neoliberalismus nicht, ja er weiß nicht einmal mehr, worum es dabei geht.„
Damit mag zwar oberflächlich manch richtige Beobachtung angesprochen sein; dennoch ist es eine ziemlich voreingenommene Beobachtung (woher kennt der Professor denn die Träume der Menschen?). Es handelt tatsächlich wohl um eine aus der marxistischen Ideologie und Teilen der Frankfurter Schule (Herbert Marcuse: Der eindimensionale Mensch) abgeleitete These. Der Mensch MUSS im Kapitalismus ein falsches Bewusstsein haben, weil 1. der Kapitalismus die falsche (dem Menschen entfremdete) Wirtschaftsform ist und weil 2. das menschliche Bewusstsein von den gesellschaftlichen Verhältnissen bestimmt wird. Wenn diese falsch sind, ist 3. auch das Denken der in diesem System befangenen Menschen falsch. So geht diese Logik, die in den marxistischen Glaubensbekenntnissen immer eine große Rolle gespielt hat, nicht zuletzt, um den Führungsanspruch der Partei zu untermauern, die ja gottlob über größere Einsichten und eben auch die richtig geschulten Intellektuellen verfügte. Mausfeld nimmt diese alte Kritik am notwendig falschen Bewusstsein der Masse in „moderneren“ Worten auf. Das klingt doch sehr nach dem intellektuellen Vorurteil, dass das Volk überwiegend aus ungebildeten Stammtischbrüdern bestehe, denen man bitte keine politische Entscheidungsgewalt geben sollte.
Da schließt sich der Kreis zu den Ideologieausführungen am Anfang des Interviews. Eine Perspektive ist nun erst recht nicht mehr zu erkennen. Das zu vermitteln, ist wohl der Sinn der mausfeld´schen „Aufklärung“. Oder wie Adorno es kurz und bündig sagte: „Es gibt kein richtiges Leben im Falschen“. Wer hier und heute auf der politischen Bühne etwas zum grundlegend Besseren bewegen will, zeigt nur, dass er die notwendige Kritik an unseren gesellschaftlichen Verhältnissen in ihrer Tiefe noch nicht verstanden hat.
Dazu folgende Anekdote: Als ich vor einiger Zeit einen Artikel mit Verbesserungsvorschlägen für unsere demokratischen Institutionen an die marxistisch geprägte Plattform „Rubikon“ geschickt hatte, schrieb der Herausgeber Wernicke postwendend: Ich wolle mit meinen konstruktiven Hinweisen zur Demokratie-Weiterentwicklung wohl „die herrschende Misere modernisieren“; Artikel abgelehnt; ich möge zum besseren Verständnis der Rubikon-Position doch bitte mal Prof. Mausfeld lesen. Was ich dann getan und verstanden habe. In diesen Kreisen wird Ideologiekritik gepflegt als wolle man sich damit um die Aufnahme in das Politbüro einer noch nicht existierenden Führungs“partei“ bewerben (Anführungszeichen deshalb, weil eine solche Partei sich ja als Repräsentant eines besseren Ganzen, nicht eines Teilinteresses versteht).
Die Quintessenz von Mausfelds Botschaft ist: Unter den kapitalistischen Machtverhältnissen ist alles falsch, die „demokratischen“ Institutionen ebenso wie das Denken der Menschen. Das korrespondiert mit der marxistischen „Analyse“ vom „ideologischen Überbau“, den isoliert ändern zu wollen natürlich keinen Sinn ergebe. Man müsse die materielle Basis, also die Eigentumsverhältnisse an den Produktionsmitteln verändern: Enteignung, Revolution. Dann erst ist der „Elitedemokratie“ die Basis genommen. Unterhalb dieser radikalen Ebene wirtschaftlicher Demokratisierung (wie Mausfeld die Enteignung etwas verklausuliert umschreibt) gibt es nur illusionsbehaftete Reförmchen, die die wahre Einsicht in das Elend eher noch weiter verschleiern und deshalb geradezu schädlich sind. Auf die Spitze getrieben hat vor 45 Jahren die RAF eine solche Denkweise, indem sie das „Schweinesystem“ (in ihren Worten) radikal und konsequent abgelehnt hat. Mausfeld spricht vornehmer, aber sein Denkmuster ist dasselbe. Meines ist es nicht.
Die sicher richtige Beobachtung, dass demokratische Institutionen auch von korrupten Volksverrätern besetzt sind, ist kein Argument gegen die demokratischen Institutionen. Das wäre nur dann der Fall, wenn man an die marxistische Theorie von der „materiellen Basis“ glaubt, die komplett und in allen Einzelheiten den „ideologischen Überbau“ incl. dem Denken der Menschen prägt.

Die Tatsache, dass in vielen Köpfen die Propaganda mächtiger Influenzer wirkt, ist kein Argument dafür, dass erst (mithilfe weitblickender und gut geschulter Intellektueller) der ganze Kapitalismus abgeschafft werden muss (wie denn? und dann?) bevor die Bürger selber richtig denken lernen können. An dieser Stelle wird das mausfeld´sche Denken antiaufklärerisch, weil es den Menschen nur als Funktion seiner gesellschaftlichen Verhältnisse und nicht als einzigartiges Individuum sieht. Das ist ein mechanistisches Weltbild aus dem 19. Jahrhundert, von Karl Marx in seiner „Deutschen Ideologie“ ausdrücklich so beschrieben, eine Gesellschaftslehre ohne Raum für den Menschen.
Natürlich ist Bildung und umfangreiches Wissen sinnvoll und notwendig, wer wollte das bestreiten? Aber warum dieses Beharren auf der Unterscheidung zwischen den wenigen Klugen und den notwendig vernebelten Vielen? Muss wirklich erst wieder eine Aristokratie aktiv werden, sei es nun eine rote, grüne oder wie auch immer farbige, bevor wir an Demokratie denken dürfen? Sehen diese Intellektuellen nicht, wie sehr dem Wohlstand gedient werden kann, wenn ohne sozialistische Revolution eine direktere Demokratie funktioniert (was am Erfolgsmodell Schweiz genauer betrachtet wird)?
Freiheit zum technischen Fortschritt
Das große Thema, wie sich technischer Fortschritt mit Demokratie verträgt, wird hier nur mit einigen Gedanken angerissen. Ausgangspunkt ist ein Artikel, den Diana Johnstone auf der Plattform seniora.org publiziert hat und auf den ich mich im Folgenden beziehe.
https://www.seniora.org/wunsch-nach-frieden/demokratie/der-grosse-vorwand-fuer-eine-anti-utopie
Sie diskutiert in ihrem Artikel über den vom Davoser Weltwirtschaftsforum 2020 ausgerufenen „Great Reset“ die Frage, welche der neuen technisch-gesellschaftlichen Entwicklungen wir im Einzelnen haben wollen und fordert, das Volk müsse wieder (?) Macht darüber gewinnen, für welche Zwecke Kapital investiert wird; privates Kapital müsse ggf. sozialisiert werden, wenn es sich dagegen sperrt. Sie nennt das eine konservative Revolution. Ein schöner Ausgangspunkt, der mehr Fragen aufwirft als Antworten gibt. Was heißt: Wirtschaft sozialisieren?
Klassisch meint man damit wohl: Industrie, Gewerbe, unternehmerisches Handeln verstaatlichen. Dazu gab es im 20. Jahrhundert einige Versuche, auch auf deutschem Boden, deren demokratische Legitimation allerdings nicht einmal von den zuständigen Entscheidungseliten ernsthaft geglaubt wurde; vielmehr bediente man sich hier der im vorigen Abschnitt beschriebenen „vorübergehenden“ Erziehungsdiktatur. So sehr hier zwar eine relativ egalitäre Gesellschaft geschaffen wurde, so wenig konnte der technische Fortschritt für den allgemeinen Wohlstand überzeugen. Ein kleines, aber repräsentatives Beispiel: die demokratisch legitimierte DDR-Auflösung hat über Nacht den Trabant durch den Golf ersetzt. Diese und viele ähnliche Bürgerentscheidungen waren auch demokratische Antworten auf den Staat als Wirtschaftsunternehmer. Zwar wird auch der Golf mit dem Staat als Teil-Aktionär produziert, aber Staat und Politik treffen hier keine unternehmerischen Entscheidungen. Unternehmerisches Staatshandeln und wirtschaftliche Prosperität waren selten gute Freunde, außer vielleicht kurzfristig nach Katastrophen zu Anschubfinanzierungen.
Das kommunistische, bzw. parteidiktatorische China ist kein überzeugendes Gegenbeispiel. Hier gibt es zwar erfolgreiches privates Unternehmertum. Die staatlichen Leitplanken entsprechen allerdings kaum demokratischen, bzw. sozialen Kriterien. Große Teile der Bevölkerung sind ohne eigene Mitsprache durch die flankierenden staatlichen Maßnahmen dem rücksichtslosen Gewinnstreben erfolgshungriger Unternehmer unterworfen. Soziale, zivilrechtliche und auch staatsrechtliche Schutzmaßnahmen sind in den meisten kapitalistischen Ländern weiter entwickelt als in China.
Sind genossenschaftliche Organisationsformen eine bessere Lösung? In einer Genossenschaft wird ein wirtschaftlicher, nicht primär ein finanzieller Zweck mit demokratischen Mitteln verfolgt; jeder Genosse hat für den verabredeten Zweck dasselbe Stimmrecht, unabhängig von seinem finanziellen Einsatz. Dieses demokratische Wirtschaftsmodell funktioniert an vielen Orten in der Welt für jeweils spezifische Ziele sehr gut und auch schon sehr lange. Aber ist auch ein VW-Konzern als Genossenschaft statt als Aktiengesellschaft denkbar? Wer wären dabei die Genossen? Die Mitarbeiter? Die Kunden? Beliebige unternehmensferne Mitbürger? Würde das Unternehmen dann noch ähnlich funktionieren und „nur“ das Geld gerechter verteilt oder bessere Autos oder etwas ganz anderes gebaut werden? Diese Fragen sind ernsthafte Überlegungen wert. Sie würden übrigens die Notwendigkeit einer Revolution mit Enteignungen einschließen. Allerdings ist nirgends eine Bürgerbewegung mit dem Ziel der Vergenossenschaftlichung von industriellen Großunternehmen zu erkennen. Dieses Fehlen ist auch eine demokratische Aussage.
Vielleicht ist die Idee einer sozialen Marktwirtschaft nicht so verkehrt, bei der der Staat auch (!) von erfolgreichen Unternehmen angemessen Steuern eintreibt und auf diesem Weg eine Infrastruktur, nicht gewinnorientierte Grundleistungen und den Rechtsstaat finanziert. Das ist zumindest theoretisch die Idee unserer Gesellschaft. Sie ist leider durch allerlei Lobbyarbeit in der Realität nur noch schwer erkennbar. Nicht zuletzt spielen dabei auch Steuerschlupflöcher eine Rolle. Deshalb folgt ein weiterführender Vorschlag zum Thema Steuergerechtigkeit, der von klügeren Köpfen als meinem ersonnen wurde, im nächsten Kapitel: Finanzierung staatlicher Aufgaben.
Wie entsteht überhaupt technischer Fortschritt, der ja für den allgemeinen Wohlstand wohl unerlässlich ist und der sowieso zum Wesen der neugierigen menschlichen Natur gehört? Heute werden Abteilungen in großen Unternehmen, zum Teil auch in Hochschulen professionell für bewusst angestrebte Entwicklungsziele eingesetzt, oft mit Steuergeldern leider auch für militärische Zielsetzungen. Außerdem gab und gibt es immer noch auch Einzelne oder Kleingruppen von Erfindern, die aus eigener Kraft und mit Bankkrediten Neues schaffen, evtl. auch vermarkten und damit oft schon umwälzende Veränderungen initiiert haben. In beiden Fällen beginnt die Entwicklung von technischen Neuerungen, die das Leben der Menschen und der Gesellschaft verändern, außerhalb demokratischer Entscheidungen. Öffentlich geförderte Forschung setzt zwar Ziele, kennt aber meist das Ergebnis nicht im Detail. Fast immer läuft die Demokratie hinter der einmal entstandenen Technik her, so wie in der Fabel der Hase hinter dem Igel herläuft, der immer schon am Ziel steht, weil er zu Mehreren unterwegs war. Auf der anderen Seite werden nicht selten auch ehebliche Mittel in die Vertiefung von bestimmten Detaillierungen gesteckt und Forscherteams gefördert ohne dass ein erheblicher Nutzen daraus entsteht – weil es sich eben um Experten handelt, die man weiter halten will, ohne dass die Geldgeber beurteilen können, ob das sinnvoll ist.
In dem durchorganisierten Wissenschaftsbetrieb fehlt manchmal die Freiheit zur „sinnlosen“ Grundlagenforschung.
Als Gottlieb Daimler und Carl Benz ihre ersten Autos bauten, haben sie niemanden gefragt, ob das gesellschaftlich gewünscht sei. Andere folgten nach und aus dem Luxusgegenstand ist ein Alltagsgegenstand geworden, der in wenigen Generation das gesellschaftliche Leben völlig verändert hat. Mit Steuergeldern wurden die Straßen gebaut, mit Gesetzen der Verkehr geregelt. Zuerst war die Erfindung, das Produkt da, dann die Nachfrage, was auch eine Art „demokratischer“ Entscheidung ist, und dann die staatlich-demokratischen Regelungen. Nachdem Auto und Nachfrage existierten, ließ sich die Entwicklung nicht mehr aufhalten, weder mit demokratischen noch mit undemokratischen Mitteln. Es lässt sich dann „nur noch“ regeln, wie technische Neuerungen von allgemeinem Interesse einer Allgemeinheit auch zugänglich sind oder wie gefährliche Neuerungen an der Verbreitung gehindert werden können. Dies sind die schwierigen Aufgaben, die der Staat als Anwalt öffentlicher Interessen zu lösen hat.

Bei vielen technischen Neuerungen, die uns heute selbstverständlich sind, konnte sich niemand das Ausmaß der gesellschaftlichen Veränderungen vorstellen bevor es stattgefunden hat. Das gilt für das elektrische Licht oder für Foto- und Filmapparate, für die Entwicklung des Gummis oder hochpolymerer Kunststoffe, für den Kühlschrank oder die Zentralheizung, für tausende Gegenstände bis hin zum Dynamit: Alfred Nobel stiftete immerhin einen Friedenspreis als er – dank Berta von Suttner – verstand, was ihm gelungen war… Es ist nicht erkennbar, wie die bloße Existenz all der massiv gesellschaftsverändernden Produkte, die unser Leben heute erleichtern oder manchmal auch erschweren, vor ihrer Erfindung hätte demokratisch beschlossen (oder verhindert) werden können. Die Dinge in dieser Reihenfolge regeln zu wollen, erst politischer Beschluss, dann Erfindung, wäre eine rührende Absicht. Das ist keine Perspektive.

Erfindungen sind oft ambivalent: Bekanntlich kann man mit einem Messer sowohl seine Mahlzeit zubereiten als auch einen Menschen töten. Diese Ambivalenz lässt sich zwar nicht auf alles, aber auf sehr vieles anwenden, sogar auf militärisch initiierte Entwicklungen: mit Kameras ausgerüstete Drohnen können auch zivile Menschleben retten oder Forschungsvorhaben unterstützen, sei es in der Archäologie, sei es in der Naturkunde. Forschung und Erfindung, sowohl von Einzelgängern in ihrer Garage, als auch in großen Instituten mit öffentlichem oder privatem Auftrag, müssen grundsätzlich möglich sein.

Technischer Fortschritt und Demokratie müssen dann an der richtigen Stelle zusammenfinden: Wenn jemand Windräder zur Energieerzeugung entwickelt, ist das eine Sache. Ob eine Gesellschaft es erlaubt, ganze Landschaften mit diesen Türmen vollzustellen, eine andere: das eine ist individuelle Freiheit, das andere muss demokratischer Entscheidung unterliegen. Das ist ein einfaches Beispiel. Komplizierter ist es bei kleinen Produkten, die der individuellen Kaufentscheidung offenstehen. Da spielt sich die „demokratische“ Entscheidung hauptsächlich durch Angebot und individuelle Nachfrage ab. Taschenrechner oder Datenchip und vieles andere, was seit Jahren unser Leben prägt, hat sich bis in die Hochtäler der Anden oder die Steppen der Sahelzone durchgesetzt. Solche Produkte stehen Wahlen und Abstimmungen grundsätzlich nicht zur Verfügung, sondern dem Markt. Demokratische Aktivität kann zwar nicht ihre Existenz, muss aber trotzdem ihre Nutzungs- und Einsatzbedingen in gewissem Rahmen regeln.
Den Zusammenhang von technischer Entwicklung und zivilisatorischer, gesellschaftlicher Entwicklung hat Fernand Braudel für die historische Kinderstube der modernen Welt, das 15. – 18 Jahrhundert, eindrucksvoll ausgebreitet (Bibliothek). Aber ich schweife ab. Wir wollten uns mit Diana Johnstones Beispielen anlässlich des „Great Reset“ beschäftigen. Johnstone charakterisiert den „Great Reset“ des WEF als Propagandaprojekt einer mächtigen Lobby zur positiven Beeinflussung der Öffentlichkeit im Interesse der großen Unternehmen, der global Player. Dann geht sie auf die aktuellen technischen Projekte konkret ein und fordert zur Auseinandersetzung damit auf.
Beispiel 1: Die Verbreitung von Telekonferenzen sei durch die Pandemie beschleunigt worden – darin sieht sie Vorteile. Das sehe ich auch so. Beispiel 2: Die Digitalisierung der Hochschulbildung, die während der Pandemie verstärkt werden musste, sieht sie kritischer und allenfalls als Ergänzung zur unverzichtbaren physischen Präsenz-Bildung. Auch dem kann ich mich anschließen und ergänzen: für Schulen gilt noch mehr: je jünger die Schüler, desto unverzichtbarer die „nicht-digitale“ menschliche Beziehung. Hier muss und kann die öffentliche Hand entsprechende Regeln setzen und auf deren Einhaltung achten.
Beispiel 3: Im Gesundheitsbereich mit Big Tech und Wellness sieht sie die Gefahr, dass wir unser individuelles Leben als immense Datensammlung betrachten und uns nach der jeweils letzten Mode stylen statt natürliche Beziehungen zu pflegen. Auch hier würde ich etwas ergänzen: Datensammlungen sind nicht nur Verführungen für das Individuum, sondern vor allem für die Anbieter und deren Geschäftspartner, die Menschen manipulieren wollen. In China findet das bereits großräumig statt und die dortige Bevölkerung steht dem Datenschutz, wohl kulturhistorisch bedingt, relativ unkritisch gegenüber. Aber auch bei uns scheint nur eine Minderheit die damit verbundene Erosion ihrer Freiheit angemessen zu erkennen. Dagegen ist dringend und umfassend Aufklärung gefordert. Niemandem soll verboten werden, alle quantifizierbaren Daten über sich unter seine Haut auf einen Chip zu implantieren und diesen ständig zu aktualisieren; aber ebenso sicher darf keine einzige Funktion des zivilen Lebens von so etwas abhängig gemacht werden.
Vorletztes Beispiel: Die Substitution menschlicher Arbeit z.B. durch Roboter beklagt Johnstone mit sehr verständlichen und nachvollziehbaren Beispielen. Allerdings sollten wir nicht vergessen, dass Arbeit seit Jahrhunderten immer wieder durch technische Entwicklungen ersetzt wurde – oft gegen anfängliche kulturpessimistische Bedenken und trotzdem oft nicht zum Nachteil eines komfortableren Lebens! Man erinnere sich nur, was zum Beispiel noch in den „Goldenen“ 1920er Jahren für eine zeitaufwändige Knochenarbeit nötig war, um einen Haushalt zu führen. Problematisch waren und sind meist nicht die Techniken selbst, sondern die oft zunächst damit verbundenen sozialen Ungerechtigkeiten. Berühmtes Beispiel ist der Heizer auf der E-Lok: hier haben die englischen Gewerkschaften beim Aufkommen der elektrischen Lokomotiven dafür gesorgt, dass die Arbeitsplätze der Kohleheizer nicht verloren gehen dürfen; sozial verständlich, aber ohne überzeugende Perspektive…
Ein anschauliches Standardwerk zur Technikgeschichte vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert hat Sigfried Giedion mit „Die Herrschaft der Mechanisierung“ übrigens bereits 1948 vorgelegt. Darin wird gezeigt, mit welchen uns heute selbstverständlichen Erfindungen das Leben der Menschen erleichtert und verbessert wurde. Auf die Mechanisierung folgte im 20. Jahrhundert die Elektrifizierung, der inzwischen die Digitalisierung folgt. Wir können heute nicht mehr entscheiden, ob wir Digitalisierung haben wollen. Wir müssen „nur noch“ eine „Herrschaft der Digitalisierung“ verhindern und stattdessen die Herrschaft über sie gewinnen. Das gilt gesellschaftlich generell, aber auch für jeden Einzelnen. Es beinhaltet zwei Aufgaben: soziale Härten vermeiden und die Einsatzbedingungen der Techniken konkret und detailliert regeln. Warum sollten wir nicht roboterartige Maschinen allerlei Drecksarbeit verrichten lassen, sie aber als Ersatz für menschliche Beziehungspflege, sei es in Altersheimen, sei es bei Telefondiensten, sei es anderswo, untersagen? Über die Existenz neuer Techniken zu klagen, hat wenig Sinn. Wir müssen die damit entstehenden gesellschaftlichen und sozialen Aufgaben bewältigen.
Das Militär und die dank neuer Techniken noch unmenschlicher werdende Kriegsführung sind Johnstones letztes Beispiel. Hier kann man sich ihrer Empörung, die sie in Form von Ironie über den „Fortschritt“ zum Ausdruck bringt, nur anschließen. Aber die neuen technischen Möglichkeiten sind da nur – schlimm genug – eine Oberfläche. Das zugrunde liegende Problem ist die Kriegsführung selbst, die so oder so von unserem demokratischen Friedenswillen gebändigt werden muss.
Interessant ist das, worauf Johnstone nicht mehr eingeht bei Ihrer Auseinandersetzung mit Buch des WEF-Chefs Klaus Schwab: Die raumgreifenden Eigenschaften der digitalen Techniken werden von Schwab mit einem raumgreifenden politischen Anspruch verbunden. Einmal mehr werden der Nationalstaat als überholtes Modell dargestellt, die Europäische Union und weitergehend eine Global Governance als politische Systeme der Zukunft propagiert. Als müssten die gesellschaftlichen und politischen Zustände sich den grenzübergreifenden technischen Möglichkeiten anpassen. Müssen nicht vielmehr die technischen Möglichkeiten dem Gemeinwohl unterstellt werden? Kann man nicht technische Normen oder überhaupt technische Anwendungen international vereinheitlichen ohne dabei demokratische Souveränität aufzugeben? Man kann. Und genau das wäre die Aufgabe demokratischen Handelns. Aber wie so oft wird auch hier der technische Fortschritt in den Dienst der politischen Propaganda gestellt.
Längst ist eine große Schar von Followern entstanden, die sich als politischer Treibriemen in die demokratischen Institutionen hinein versteht, um die Ziele der Global Player inkl. des Demokratie-Abbaus „von unten“ durchzusetzen – oder auch nur die Akzeptanz dafür zu erhöhen. Dank einer Propaganda, die auf lückenhafte demokratische Bildung setzt, glauben viele sogar an das Gute ihres Tuns. Tatsächlich brauchen wir aber keine NGOs, die Lobbyarbeit für global Player leisten und dabei übrigens oft genug mit öffentlichen Geldern gesponsert werden, also eigentlich GOs sind; sondern wir brauchen Bürgergespräche und -initiativen außerhalb von interessengesteuerten „N“GO-Strukturen. Fragen wie Diana Johnstone sie ansatzweise und beispielhaft gestellt hat, nämlich wie wir mit neuen technischen Entwicklungen gesellschaftlich umgehen wollen, sind anspruchsvolle und notwendige Fragen!
Damit bleibt dieses Kapitel am Ende erst einmal offen. Nicht ganz: es wird klar, dass wesentliche Entscheidungen über den Einsatz neuer Techniken in die demokratischen Institutionen gehört, nicht in die inoffiziellen pressure groups, wo technischer Fortschritt als weiteres Argument für den Abbau von demokratischer Rechtsstaatlichkeit missbraucht wird. Ergänzen muss man, dass es auch Aufgabe des Staates ist, technische Entwicklungen zu fördern, um erkennbare Probleme im Sinne der Gemeinschaft zu lösen; zum Beispiel die Frage der Endlagerung von Atommüll oder globale Umweltschutzregelungen oder die Entwicklung wichtiger Medikamente und vieles andere.
Nachtrag: mein Kommentar zu dem Beitrag von Diana Johnstone, der den vorstehenden Abschnitt ausmacht, hat Diana Johnstone wie folgt kommentiert: „Eine bessere Antwort auf meinen bescheidenen Vorschlag als die Ihre konnte ich nicht erhalten. Sie fügen meiner einfachen Intuition das solide konkrete Denken eines Ingenieurs hinzu. Ich bin erfreut und geehrt, dass meine Idee so perfekt aufgegriffen und weiterentwickelt wurde.“
Finanzierung staatlicher Aufgaben
In diesem Abschnitt geht es nicht um das Was? – welche Aufgaben hat der Staat zu finanzieren? Dazu wird unter Kernthemen_Sozialstaat etwas gesagt. Sondern um das Wie? Woher kommt das Geld, wie werden Steuern erhoben? Selbstverständlich wird hier keine Patentlösung vorgestellt, die auf einem Bierdeckel alle Probleme löst. Sondern es wird ein Vorschlag aufgegriffen, der auf gerechte Weise zu mehr und sogar gerechteren Steuereinnahmen führen würde. Wenn man das denn will…
Wir erleben ja schon seit längerem, dass früher selbstverständliche Aufgaben des Staates durch Privatisierungen inkl. Gewinnorientierung ersetzt werden. Wobei über viele wichtige Fragen in diesem Zusammenhang direkte demokratische Entscheidungen nie stattgefunden haben. Die Privatisierung wird gerne mit angeblich besserer Effektivität und mit fortschreitenden Finanzierungsproblemen bei den öffentlichen Händen begründet. Ob es für arme Menschen effektiv ist, wenn lebenswichtige Grundleistungen einem Profitgedanken unterworfen werden, muss wohl nicht lange überlegt werden. Wer ein paar Jahrzehnte zurückblicken kann, fragt sich auch, wieso es früher möglich war, Schulen zu bauen und zu pflegen, ohne dass es hereinregnet und in denen regelmäßig die Fenster geputzt werden, wieso es möglich war, städtische Hallenbäder zu betreiben, die auch damals ein Zuschussbetrieb waren… und so weiter. Jedem fallen weitere Beispiele ein. Gleichzeitig wurde eine Mehrwertsteuer schrittweise erhöht und für manche Leistungen Gebühren erhoben, die es früher nicht gab. Und die Staatsverschuldung ist in früher unvorstellbare Höhen gestiegen. Wurden da öffentliche Gelder falsch ausgegeben?

Diese Frage wird hier nicht vertieft; sie wäre aber ein lohnendes Thema. Sondern es wird auf eine mögliche Steuerquelle hingewiesen, die bisher nicht genutzt wurde, obwohl kein vernünftiges Argument dagegen spricht. Der Hinweis greift die Tatsache auf, dass die Steuereintreibung bei potenziell großen Steuerzahlern nicht richtig funktioniert, vorsichtig formuliert. Die Spatzen pfeifen es von den Dächern, dass große Firmen über entsprechende und zweifellos legale „Optimierungsmöglichkeiten“ verfügen. Abgesehen davon werden gerade auf große Geldtransaktionen, die in den Büchern der Banken in schwindelerregendem Maß stattfinden, gar keine Steuern erhoben. Warum nicht?
Das leitet über zu dem interessanten Vorschlag aus der Schweiz, der dieses Problem beinahe so lösen könnte wie Alexander einst den gordischen Knoten gelöst hat: Die Microsteuer. Bezogen auf Schweizer Verhältnisse wird dieser Vorschlag über folgenden Link genauer vorgestellt.
https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2021/nr-11-18-mai-2021/plutokratie-oder-demokratie
Der Vorschlag ist in der Schweiz bisher nicht positiv abgestimmt worden, aber das soll niemanden daran hindern, weiter darüber nachzudenken und ggf. tätig zu werden. Kurze Erklärung:
Microsteuer meint, dass auf jeden Vorgang, bei dem Geld bewegt wird, automatisch eine Steuer erhoben und abgebucht wird, zum Beispiel 0,1 Promille, also bei einer Bewegung von 100 €: 1 Cent. Das gilt sowohl für Transaktionen zwischen den Banken als auch bei „normalen“ Überweisungen und schließlich auch, wenn ich Bargeld am Automaten abhebe. Man kann heute Software so programmieren, dass es problemlos möglich ist, bei all diesen Bewegungen einen geringen Promillesatz einzubehalten. Das einbehaltene Geld wird auf ein staatliches Treuhandkonto gebucht; ein Bruchteil davon kann auch als Bankbearbeitungsgebühr bei der Bank bleiben. Dieses System funktioniert sowohl, wenn ich mir 100 € Bargeld am Automaten hole als auch wenn jemand (nicht ich!) 100 Millionen € dreimal täglich von Luxembourg nach Delaware und von dort nach Düsseldorf oder Lüdenscheid und wieder zurück transferiert. Bei einem einzelnen Transfer fallen dann bereits 10.000 € an, bei mehreren Transfers das Mehrfache.

Das Bestechende an dieser Idee, die in anderer Form, aber nicht so umfangreich, als Transaktionssteuer schon einmal vor Jahrzehnten im Gespräch war, ist die Tatsache, dass es keine Möglichkeit zur Steuerhinterziehung gibt. Es werden vor allem große Geldbewegungen erfasst, die heutzutage in manchen Kreisen üblich sind, obwohl es sich dabei oft nur um fiktive Buchungen handelt, hinter denen keine realen Wertbewegungen stattfinden – aber über automatische Abbuchungen würden dann auch dort Steuern anfallen. Und zwar hohe Beträge für den Fiskus, obwohl es nur minimale Beträge für die nominellen Buchungen sind. Mit anderen Worten: es würden Geldquellen für den Staat erschlossen werden, die es bisher zum Teil nicht gab oder die zum Teil umgangen wurden.
Natürlich können damit nicht alle Steuern ersetzt werden, denn verschiedene Steuereinnahmen gehören in verschiedene öffentliche Töpfe und das ist auch gut so. In der Schweiz sollte damit die Bundessteuer und die (dem Bund zustehende) Mehrwertsteuer ersetzt werden. Nach überschlägigen Berechnungen wären dort bereits bei einem Micro-Steuersatz von nur 0,05 Promille also 1 Cent von 200 € die bisherigen Einnahmen durch Bundes- und Mehrwertsteuer übertroffen worden.
Das System kann von Fachleuten zweifellos zu einer „Marktreife“ gebracht werden, die dazu führt, dass 1. auch große Geldbewegungen besteuert werden, 2. geringer Verdienende nur im Maß ihrer geringeren wirtschaftlichen Aktivität belastet werden, 3. zum Beispiel die Mehrwertsteuer entfallen könnte, was nicht nur ärmere Menschen, sondern „die Wirtschaft“ insgesamt entlastet und evtl. 4. sogar manch ein Verwaltungsaufwand durch die digitale Automatisierung vereinfacht werden könnte, was also öffentliche Ausgaben einsparen könnte.
Im Ergebnis käme es zu höheren und zugleich gerechteren Staatseinnahmen, sodass der Staat seine eigentlichen Gemeinschaftsaufgaben (siehe Kernthemen_Sozialstaat) besser wahrnehmen könnte statt sie zu privatisieren oder anderweitig abzubauen. Finanzierungprobleme wären dafür kein Argument mehr. Dass auch sonstige möglicherweise unnütze Staatsausgaben unter die Lupe zu nehmen sind, steht unabhängig davon auf einem anderen Blatt.
Freund und fremd
Viele kluge und weniger kluge Köpfe haben sich immer wieder Gedanken darüber gemacht, ob der Mensch von Natur aus „gut“ sei, womit immer etwas Altruistisches gemeint ist, oder „böse“, womit dann das Egoistische und Rücksichtslose gemeint ist. Geschichte und Gegenwart sind voll von Beispielen für beide Seiten und man kann bezweifeln, ob solche eher moralischen Fragen (gut? böse?) zu irgendeinem Ziel führen.
Interessanter ist es, wenn man mit einem anthropologischen Blickwinkel zu verstehen versucht, warum der Mensch in seiner Entwicklungsgeschichte für beide Seiten umfassendes „Beweismaterial“ liefert. Einen Schlüssel sehe ich darin, dass es schon seit Urzeiten in der Entwicklung der menschlichen Gesellschaften ein Innen und ein Außen gibt, welches unser Denken und Fühlen und Handeln bis heute prägt. Ein Innen und ein Außen in den menschlichen Beziehungen war und ist die praktische Lebensbedingung von uns Menschen. Ich sehe darin eine gute Basis für das Verständnis unserer menschlichen Natur.
Anthropologisches
Die Menschwerdung hat sich schon seit der Entwicklung des aufrechten Ganges, bzw. sicher noch früher in Gruppen abgespielt, in sozialen Verbänden, innerhalb derer die gegenseitige Hilfe eine Überlebensbedingung war. Diese menschliche Eigenschaft gegenseitiger Hilfe ist so alt und so notwendig, dass sie zu einem menschlichen Instinkt wurde, der uns nun angeboren ist und nicht erlernt werden muss. Leider kann er auch verschüttet und an seiner Entfaltung gehindert werden, durch falsche Vorbilder und Einflüsse, durch Gewalterfahrungen und Bestrafungen, manchmal auch durch gut gemeinte Belohnungen und anderes mehr. Trotzdem haben heute bereits Kleinkinder, die noch nicht sprechen können, den Impuls zu helfen, was z.B. Tomasello in seinen Beobachtungen eindrücklich gezeigt hat (siehe Bibliothek).
Man mag diesen Instinkt als Beweis für die natürliche „Güte“ des Menschen sehen, wenn man in moralischen Kategorien denken will. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass diese Güte zunächst in der eigenen Gruppe, in der engeren Umgebung, in unmittelbaren persönlichen Beziehungen lebt, nicht in unendlich großen Gruppen oder in dem Abstraktum der ganzen Menschheit. Die Menschen haben die längste Zeit ihrer hunderte tausend Jahre langen (Vor-) Geschichte in überschaubaren Gruppen gelebt und sich von anderen Gruppen mehr oder weniger abgegrenzt. Seit den letzten ca. zehn Jahrtausenden entstand durch technische Fortschritte, Erkenntnisse und Fähigkeiten ein Bevölkerungswachstum, das zu größeren Clans, zu Städten und Staatsgebilden führte, in denen man sicher nicht mehr den persönlichen Überblick hatte, wo aber doch das Bewusstsein und auch die Realität einer gemeinsamen Identität gepflegt wurde und existenziell war. Schon sehr früh geschah das zum Beispiel durch Tätowierungen, wurde dann auch durch Kleidung erkennbar, durch eigentümliche Sitten und Gebräuche, eigene Sprache, und – nicht zu unterschätzen! – durch Erzählungen einer gemeinsamen Geschichte.

In dem Abschnitt „Nationale Vielfalt“ unter den Kernthemen wird daran erinnert, dass die sprachliche Vielfalt auf dieser Welt gerade dort am größten ist, wo schon am längsten Menschen auf mehr oder weniger begrenztem Raum (zusammen?) leben. Auf der Insel Neu Guinea, seit zig Jahrtausenden besiedelt und weitgehend isoliert geblieben, leben heute (oder bis vor kurzem) noch über 1.000 Sprachen, die sich oft untereinander nicht verstehen. Im Pazifikstaat Vanuatu sprechen weniger als 300.000 Menschen über 120 Sprachen und allein auf einer der Inseln finden sich 30 Sprachen unter 25.000 Menschen. Auch in Ostafrika, der Wiege der Menschheit, gibt es bis heute viele Sprachen, die von relativ wenigen Menschen gesprochen werden und die zu Dutzenden Amtssprachen in einzelnen Staaten bis heute führen.
Die kleinen, später größeren Gruppen haben natürlich immer auch Kontakt zu anderen gehabt. Ohne kontinuierliche Kontakte über größere Entfernungen wären schon in der Steinzeit wohl kaum in unterschiedlichen Gegenden Europas, Afrikas und Asiens ähnliche Höhlenmalereien entstanden. Nach Stonehenge sind vor 4.000 Jahren Menschen aus dem Gebiet des heutigen Süddeutschland gereist; Bronze-Gegenstände sind vor über 3.000 Jahren in Griechenland mit Kupfer aus Zypern und Zinn aus England gefertigt worden; noch bevor die Menschen Eisen herstellen konnten gab es einen Salz- und Bernsteinhandel zwischen der Ostsee und dem Mittelmeer – um nur ein paar Beispiele zu nennen. Aber die Beziehungen zu den Fremden war trotzdem immer eine andere als die zu den Eigenen.
Das „andere“ bedeutet nicht notwendig Feindseligkeit oder Krieg; es gibt uralte Traditionen von Gastfreundschaft gegenüber Fremden, aber eben auch einen Unterschied im Maß der gegenseitigen Hilfe und des Zugehörigkeitsgefühls. Dieser Unterschied zwischen den Fremden und den Eigenen muss man als eine alte Realität anerkennen, sodass auch sie vielleicht zum instinktmäßigen Bewusstsein des Menschen gehört. Denn über lange Zeiträume der Menschheits-(vor-) geschichte war die Not des Überlebens der Normalzustand für die meisten Menschen – und da stehen einem die eigenen Leute näher als die fremden, auch wenn man mit ihnen kooperiert. Aber wenn es ums eigene Überleben – oder oft auch nur ums besser-leben – geht, hat die Kooperation Grenzen. Das ist die Basis für die Behauptung, dass der Mensch des Menschen Wolf sei. Gerade wo technischer Fortschritt in einer Gruppe zu einem gewissen Wohlstand geführt hat, gab es Rivalität durch andere Gruppen, was mindestens seit der späten Steinzeit zu Raubzügen und Kriegen gegen andere geführt hat. Bereits die Vor- und Frühgeschichte ist eine Geschichte von Kriegen und Waffentechnik einerseits, notwendigen Schutzburgen und Verteidigungsmitteln andererseits.

Das Bild des Innen und Außen als Orte des Friedens, bzw. der Gewalt ist keine willkürliche Behauptung und auch keine belanglose Selbstverständlichkeit, sondern zentral für die Frage nach „Gut“ oder „Böse“. Das zeigt eine Kleine Geschichte der Antike (siehe Bibliothek: Gehrke, Seite 63): „Gegen Ende des 7. Jahrhunderts (vor Chr.) wurden diese kleinen Siedlungen in einem Gründungsakt nach etruskischem Ritus zu einer Stadt (nämlich Rom) zusammengefasst; durch eine rituelle Linie in Form einer Ackerfurche wurde sie umgrenzt, das Innere (Zivilisierte und Friedliche) vom Außen (dem Wilden und Bedrohlichen) geschieden.“ Dieses beliebige Beispiel darf man sich auf der Zunge zergehen lassen; es ist keine Ausnahme, sondern repräsentiert das menschliche Tun und Denken durch die frühen Jahrtausende der Zivilisation und in abgewandelten Formen bis heute.
Die menschlichen Gesellschaften haben sich im Verlauf der Geschichte und der technischen Entwicklungen weiter differenziert, sodass in den größer werdenden Gemeinschaften verschiedene Klassen mit unterschiedlichen Funktionen, unterschiedlichen sozialen Stellungen und Reichtümern entstanden, die auch innerhalb derselben Kultur zu verschiedenen Formen von Innen und Außen führten. Innerhalb einer größeren Gruppe, einem Kulturraum gibt es interne Gruppen, wo sich die Individuen der „eigenen“ Gruppe im Zweifel näher stehen als den anderen. Das müssen keine volkswirtschaftlich oder sozial verschiedenen Klassen sein, sondern es können (um heutige Beispiele zu nennen) Fußballklubs, politische Parteien, Fanclubs von Schlagerstars oder einfach Familien- oder Kollegenkreise etc. sein. Man kann sich Menschen aus ähnlichen Gruppen in anderen Nationen näher fühlen als Menschen aus ferneren Gruppen der eigenen Nation. Die Varianten sind vielfältig, aber die persönliche Sozialität und Identität bleibt etwas anderes als ein unpersönliches Menschheitsgefühl. Das ist auch dann so, wenn sich gerade in der modernen Welt die Identitäten selbstverständlich verändern können und über eine gewisse, wenn auch eher gemächliche Dynamik verfügen.
Die heute entstehenden unpersönlichen digitalen „Freundeskreise“ sehe ich allerdings nicht als etwas „Eigenes“ im angesprochenen Sinn: hier wird im Gegenteil die Bildung und Pflege personaler Sozialität gestört, wenn nicht sogar zerstört. Nicht zufällig entstehen psychische Störungen bei vielen Jugendlichen, die einen großen Teil ihres Lebens nur mit diesen „Freunden“ am Bildschirm verbringen.
Kultur-Politisches
Politische Propagandisten und Geschäftemacher nutzen die menschliche Eigenschaft zur Gruppenbildung gern für ihre Zwecke aus. Die Geschichte illustriert bei genauerem Hinsehen sowohl Beispiele für negative Gruppenbildungen bis hin zu Hetzmeuten, die für fremde oder sinnlose Zwecke missbraucht wurden, als auch umfangreiche Ausnahmen und manchmal überraschende Konstellationen, zu denen die beteiligten Menschen sich positiv genossenschaftlich verbunden haben. Die Menschen sind eben Individuen mit reicher Erfindungsgabe und mit Phantasie, die manchmal auch in die Irre führen kann. Zu Gewalttätigkeiten zwischen Gruppen führt das (abgesehen von reinen Überlebenskämpfen) übrigens vor allem dann, wenn Herrscherhäuser, Feudalherren, also ohnehin schon Reiche, Kriege planen und sie von Gefolgsleuten im Namen eines propagandistisch vorgegebenen Ziels führen lassen. Oder, wie Michel de Montaigne vor über 400 Jahren schon sagte: Nicht der Mangel, sondern der Überfluss gebiert die Habsucht. Die Kriege, die seit ca. 100 Jahren auch von Demokratien geführt wurden und werden, verdienen unter diesem Gesichtspunkt die kritische Frage: was sind das für Demokratien?
Diese Frage wird hier nur in den Raum gestellt und nicht vertieft. Wir bleiben bei der – ich würde sagen: anthropologischen – Feststellung, dass die Menschheit es gelernt und jedes Individuum es verinnerlicht hat: es gibt Eigene und Fremde, denen man in seinem Denken, Fühlen und Handeln entweder näher oder weniger nah und je nach den Umständen auch feindlich gegenüber steht. Das ist nicht moralisch mit gut oder böse zu bewerten, sondern als ein Bestandteil der menschlichen Natur zu akzeptieren. Jeder von uns weiß und spürt das und empfindet es vielleicht als überflüssig, überhaupt darauf hinzuweisen. Es ist aber bedeutsam auch für das Nachdenken über Demokratie, über Nation, die manchmal allzu oberflächlich abgelehnt oder über ein „Weltbürgertum“, das manchmal allzu oberflächlich anvisiert wird.
Der Mensch ist nicht nur ein flexibles und lernfähiges, sondern auch ein lernbedürftiges Wesen. Ein zum Beispiel in Argentinien geborener Mensch kann sicherlich, wenn ihn jemand nach der Geburt in eine Familie verschleppt, die in Japan lebt, zu einem Mitglied der japanischen Gesellschaft werden, dem das Argentinische lebenslang fremd bleibt. Und umgekehrt. In diesem Sinne könnte man tatsächlich eine Weltbürgerschaft postulieren, die jedem Menschen als Potenzial innewohnt. Aber zu seinem Menschsein gehört eben auch, dass er Japaner geworden ist. Oder Argentinier. Was die japanische Kultur aus ihm gemacht hat, ist Teil seines Menschseins geworden, welches man ihm nicht nehmen kann. Und welches – ohne Bewertung – ein etwas anderes Menschsein ist als das eines Argentiniers. Es geht ums Konkrete, um das, was wirklich entstanden ist und existiert, nicht um das abstrakt-allgemeine, das auch möglich gewesen wäre. Natürlich wäre vieles anders möglich – ist es aber nicht geworden… Und das Gewordene verdient Respekt.
Dieses Beispiel will sagen, dass jeder Mensch die ihn prägende Kultur wie eine zweite Haut mit sich trägt; anders konnte er gar nicht Mensch werden. Die zweiten Häute sind weltweit verschieden. Da gibt es Menschen, die schon in jungen Jahren, vielleicht weil Vater oder Mutter Diplomat waren, viel herumgekommen und damit viel offener und flexibler für verschiedene Lebensumstände geworden sind als jemand, der ein Leben lang kaum aus seinem Dorf herausgekommen ist. Jeder von beiden hat eine spezielle kulturelle Prägung, einschließlich der familiären Einflüsse, die seine Individualität mit geprägt haben. Keines der beiden Individuen ist mehr oder weniger wert. Beide bewegen sich überwiegend in Kreisen mit Menschen, die ihnen ähnlicher, vertrauter sind und die dem jeweils Anderen fremder wären. Die Kreise des einen mögen größer und vielfältiger sein als die des Anderen. Aber bei jedem der beiden gehören sie zu dem so entstandenen Individuum mit seiner spezifischen Sozialnatur.

Vor 50.000 Jahren haben sich eher kleine Menschengruppen zu einer optimalen Größe zusammengefunden, um das Überleben zu sichern und gegen schwierige Umweltbedingungen und ggf. räuberische Attacken von anderen Gruppen zu bestehen. Auch heute lebt jeder trotz komplexer Zivilisationen in begrenzten Kreisen, die selbstverständlich differenzierter und weiter gestreut sind, aber eben nicht unendlich und auch nicht beliebig austauschbar. Die gesellschaftlichen Bedingungen für die Definition von Eigenem und Fremden sind komplexer geworden, aber die grundsätzliche Unterscheidung besteht weiter. Nur die menschlichen Beziehungen innerhalb einer vorgefundenen, mit Regeln und Riten vertrauten und mindestens nach innen solidarischen Gemeinschaft ermöglichen es auch heute, dass ein Mensch zu dem Individuum wird, das sein Leben später selbstbestimmt gestalten kann, vielleicht sogar so, dass er am Ende seine japanische Heimat verlässt, um in Argentinien zu leben. Das kann er aber nur, weil er eine bestimmte familiäre, kulturelle, sprachliche Heimat hatte, die ihn zum entscheidungsfähigen Menschen werden ließ.
Exkurs zur Gewalt gegen die Eigenen
Mit diesen Überlegungen wird keineswegs bestritten, dass es auch in engen Beziehungen, in Familien, im Freundeskreis zu Hass und Gewalt kommen kann. Hier spielen fehlende positive Beziehungen in früher Kindheit, falsche Erziehungsmaßnahmen, schlechte Vorbilder, eigene Gewalterlebnisse oder traumatische Erfahrungen eine Rolle, die das Individuum betreffen und in das Gebiet der Psychologie gehören. Sie tangieren zunächst nicht das öffentliche Leben, außer wenn allzu neurotisch oder psychopathisch beeinträchtigte Menschen in verantwortungsvolle Positionen gelangen. Derartiges gab und gibt es selbstverständlich. Aber das ist ein anderes Thema als der Hinweis auf das Menschsein, das nur mit einer vertrauten, aber nicht unendlich großen, bzw. unpersönlichen Gemeinschaft gelingt. Zu meinem Menschsein gehört der größte Teil der Menschheit nicht dazu, weil ich ihn im alltäglichen Leben nicht in persönlicher Beziehung wahrnehmen kann. Diese Struktur des Innen und Außen in den menschlichen Gesellschaften ist eine andere Basis für Feindseligkeit und Gewalt als die Hassgefühle, die in unmittelbaren, aber misslungenen persönlichen Beziehungen ihre Wurzel haben und die deshalb gerade in engen Beziehungen des Innen eine andere Art von Feindseligkeit erzeugen als sie in den gleichgültigeren Beziehungen gegen des Außen auftritt.
Die Unmöglichkeit einer emotionalen Beziehung zur ganzen Menschheit beinhaltet ja notwendig eine gewisse emotionale Gleichgültigkeit gegenüber unbekannten Einzelnen, die leichter in eine abstrakte Feindschaft umgedeutet werden kann, während eine vorhandene, aber falsch geführte emotionale Beziehung zu einem Nächsten echte Hassgefühle hervorrufen kann. Das „Böse“ gegen Fremde basiert auf zu großer Entfernung, auf fehlender Personalität, das „Böse“ gegen die Nächsten dagegen auf falsch geführter persönlicher Beziehung, wenn man will: auf zu viel Nähe. Das Mittel gegen Misstrauen und Hass gegenüber den schlecht erlebten Nächsten ist dann auch mehr ein emotionales, psychologisches, während das Mittel gegen Feindschaft gegenüber Unbekannten eher ein intellektuelles, auf Bildung beruhendes ist. Dazwischen gibt es fließende Grenzen. In enger persönlicher Beziehung entstandene Hassgefühle können zweifellos auch gegen unbekannte Volksgruppen gewendet werden. Dafür gibt es mehr als genug Beispiele.
Ich möchte an dieser Stelle nicht verschweigen, dass diese Überlegungen nur ein Annäherungsversuch an die Frage sind, warum Menschen manchmal unglaublich gewalttätig und anhaltend hassgesteuert handeln können. Elias Canetti spricht von dem Stachel, den eine Gewalterfahrung im Individuum setzt – und der durch eigenes gewalttätiges Handeln weitergegeben werden will. Alfred Adler betont die Erfahrung der Minderwertigkeit, die das Individuum im Prozess des Heranwachsens begleitet, womit eine Quelle von Irritationen und Fehlverhalten erkannt ist. Aber die ungezügelten Hass- und Gewaltausbrüche auf verschiedenen Ebenen bleiben im Kern auch ein Rätsel, welches selbst von einem beeindruckenden und brillant geschriebenen, aber eher deskriptiven „Traktat über die Gewalt“ (Bibliothek) nicht gelöst werden kann.
Wahr ist aber auch: sobald persönliche Beziehungen ins Spiel kommen, können umgekehrt aus eigentlich Fremden sehr schnell Genossen in einem positiven Sinn werden. Eindrucksvolles Beispiel sind die Verbrüderungen, die im Ersten Weltkrieg zwischen den französischen und deutschen Schützengräben zur Weihnachtszeit stattgefunden haben als die Soldaten in jeweiliger Hörweite Weihnachtslieder sangen – was zu gemeinsamen deutsch-französischen Weihnachtsfeiern führte. Und warum haben sie nach Weihnachten wieder zu den Waffen gegriffen? Weil sie sonst nicht von vorne, sondern von hinten erschossen worden wären, von ihren Vorgesetzten! Es gibt allerdings auch Belege dafür, dass sehr viele Soldaten bewusst schlecht gezielt haben… Ein umgekehrtes Beispiel ist die moderne Kriegsführung, bei der die menschlichen Opfer nur noch Ziele außer Sichtweite oder Punkte auf dem Computerbildschirm sind. Diese Unpersönlichkeit wird auf erschreckende Weise bereits Kindern und Jugendlichen „spielerisch“ beigebracht. Die späteren Opfer sind aber weiterhin aus Fleisch und Blut.
Zukünftiges
Zurück zur Demokratie. Wenn wir uns einig sind, dass konkrete Zivilisationen, Kulturkreise lebensnotwendig sind, um jedes Menschenkind bis zum Erwachsenenalter zu einem selbständigen Individuum werden zu lassen, dann müssen wir erstens gewachsene Kulturkreise schützen und zweitens den Menschen in diesen Kreisen die Möglichkeit lassen, ihre Regeln und Riten selbst weiter zu entwickeln. Selbstbestimmt und „nachhaltig“ geht das nur von innen heraus. Politisch gewendet ist dies das Argument sowohl für eine Traditionspflege im Sinne von Weitergabe von Wissen und Können an die nächste Generation, als auch für dezentrale politische Entscheidungsstrukturen, um Innovationen entwickeln zu können, die von den Beteiligten gewünscht und somit auch stabil sind. Die Alternative wäre das Entstehen von Herrschaft anstelle von Genossenschaft (siehe hierzu diese Abschnitte unter Kernthemen).
Aus der uralten Dichotomie des Innen und Außen in den menschlichen Beziehungen folgte in der Vergangenheit oft genug, dass gegenüber dem „Außen“ auch Gewalt erlaubt sei, zumindest eher als gegenüber dem „Eigenen“. Das mag uns gefallen oder nicht, es ist unbestreitbar. Die Sozialität des Menschen ist eben eine personale, sie beruht auf persönlicher Beziehung und Erfahrung und ist gegenüber unbekannten oder einem anderen Kulturkreis angehörenden Menschen tendenziell labiler. Dass gegenüber den außen stehenden Menschen oder Gruppen die Gewalt leichter von der Hand geht, basiert neben den Einflüssen von interessierter Propaganda auf der mangelnden persönlichen Beziehung zu diesen Personen. Sie gehören nicht zu unserer Zivilisation, zu unserer Identität, warum soll also unser zivilisiertes Verhalten ihnen gegenüber gelten – so ungefähr könnte man die Gefühlslage ganz grob beschreiben, die im Vorfeld von Gewalttätigkeiten aufgerufen werden kann. Eine Gewaltbereitschaft ist nicht notwendig als „Urtrieb“ vorhanden, kann aber gegenüber dem unpersönlichen Fremden leichter hervorgerufen werden. Die SS-Schergen, die im Alltag die Juden vergast, aber mit ihrer Familie friedlich Weihnachten gefeiert haben, sind nur ein Extrembeispiel.
Nach diesen Überlegungen kann man die Eingangsfrage nach dem Gut und Böse sehr viel praktikabler als eine Aufgabe formulieren: es ist eine erstrebenswerte Zukunftsvision, dass die für das Innen normalerweise üblichen genossenschaftlichen, friedlichen Regeln auch auf das Außen übertragen werden. Das ist auch eine intellektuelle Abstraktionsleistung, denn es fordert für Unpersönliches (niemand kennt alle Menschen dieser Welt persönlich) ähnliche Umgangsformen wie für Persönliches; sozusagen eine Gastfreundschaft auch ohne persönliche Kenntnis des Anderen. In diesem Sinne kann das Wort der Bergpredigt – anders als Helmut Schmidt einmal meinte – schon als eine prophetische Orientierung für ein vernünftiges politisches Leben (wenn auch nicht direkt als „Regierungserklärung“) verstanden werden: „Ihr habt gehört, dass gesagt ist: Du sollst Deinen Nächsten lieben wie Dich selbst (3. Mose 19, 18)… Ich aber sage Euch: Liebet Eure Feinde…“ (Matthäus 5, 43 ff). Zugegeben: vielleicht ist Lieben an dieser Stelle etwas übertrieben formuliert oder auch nur unglücklich übersetzt. Aber mit dieser Aufforderung schlägt das Neue Testament tatsächlich eine neue Seite in der Menschheitsgeschichte auf: die Außenbeziehungen mit der gleichen Empathie pflegen wie man es (bestenfalls) bei den Innenbeziehungen gewöhnt ist. Diese Aufgabe ist uns gestellt bis heute.
Das heißt natürlich nicht, dass wir die ganze Welt nur noch „innenpolitisch“ betrachten, wie das manche politischen Aktivisten machtpolitisch missverstehen (wollen), sondern dass wir Respekt haben vor der Verschiedenheit der Kulturkreise, der Lebensräume, der Rechtsräume, so wie vor unserem eigenen, weil diese in ihren unterschiedlichen Formen und Farben zu den Lebenswirklichkeiten des Menschseins gehören. Auch wenn ihnen selbstverständlich eine Dynamik innewohnt. Es sei dahin gestellt, ob sich im Zuge der technischen Entwicklungen eines fernen Tages eine einheitliche globale Weltkultur etabliert – aber selbst wenn diese Horrorvorstellung Realität werden sollte, wird das nichts daran ändern, dass zur Menschwerdung immer die menschliche Beziehung in überschaubaren Gruppen gehört. Und die wird weltweit wohl immer zu unterschiedlichen „zweiten Häuten“, also unterschiedlichen Kulturen führen. Ein Innen und ein Außen, bzw. eigen und fremd werden bleiben. Aber wir müssen lernen, fremd nicht auf feindlich, sondern auf friedlich zu reimen.
Seit ein paar hundert Jahren organisieren sich Kulturkreise nicht nur lokal oder regional, sondern auch als Nationen, als Staaten. Es gibt oft keine identischen Übereinstimmungen zwischen Lebensraum, Kultur, Nation, Staat; dafür sind die historischen Prozesse einschließlich der immer wieder und immer noch stattfindenden Gewalttätigkeiten dann doch zu komplex. Aus den Abweichungen zwischen Lebensraum, Nation, Staat können Streitigkeiten entstehen, weil Staatsgrenzen als falsch gezogen empfunden werden, oft zu recht, denn Grenzen sind fast immer Ergebnisse von Kriegen. Aber um das zu korrigieren, darf Krieg in der Zukunft niemals mehr eine Lösung sein.
Dass die Natur des Menschen als ein soziales Gruppenwesen leider immer wieder zu Feindseligkeiten gegen Menschen aus anderen Gruppen einlädt, ist ein großes Problem. Aber man löst es gerade nicht dadurch, dass man die persönliche Gruppenbezogenheit des Menschseins leugnet oder gar abschaffen will, sie mit aggressivem Nationalismus oder Rassismus in einen Topf wirft, und so tut als gäbe es nichts zwischen Individuum und Weltbürger. Sondern indem man das, was es dazwischen gibt, nämlich die Vielfalt der menschlichen Kulturen und Rechtsräume, zu respektieren lernt und als friedliches Nebeneinander und Miteinander pflegt. Und wenn man – vielleicht zu Recht – davon überzeugt ist, dass andere Kulturräume zu weit von demokratischen, menschengerechten Zuständen entfernt sind, so muss man wissen: es gehört zur Menschenwürde, dass die Betroffenen das erstens selbst auch so sehen und zweitens ggf. dann selbst ändern.

Bleibt für die Gegenwart nur noch nachzutragen, dass auch die deutschen Außenministerinnen seit der deutschen Einheit die hier dargestellten Selbstverständlichkeiten mehrheitlich leider „vergessen“ haben. Natürlich waren immer die anderen daran schuld.
Nationalismus

Auf dieser Homepage wird viel Verständnis geäußert für dezentrale Entscheidungsstrukturen, ja sogar für nationale Souveränität und Ähnliches. Damit gerät man schnell in den Verdacht, ein ewiggestriger Nationalist zu sein. Deshalb soll hier der Unterschied dieser Haltung zum Nationalismus dargestellt werden. Man könnte es kurz machen und mit De Gaulle (sinngemäß) sagen: „Ein Patriot ist jemand, der sein Vaterland liebt, ein Nationalist ist jemand, der die anderen Nationen hasst.“ Aber ausführlicher und besser zum Weiterdenken geeignet ist ein Essay von George Orwell aus dem Jahr 1945, erstmals auf Deutsch 2020 erschienen (siehe Bibliothek).
Orwells Definition und Merkmale
Orwell beschreibt, wie Menschen in bestimmten Denksystemen so befangen sind, dass sie die Realität übersehen oder ignorieren. Er bezieht sich beispielhaft auf die politischen Denkschulen seiner Zeit und betont, dass er das von ihm „Nationalismus“ genannte Phänomen in einem sehr weiten Sinn versteht: als eine Bezeichnung für geschlossene Weltanschauungen, wozu er manch konservative oder katholische ebenso zählt wie stalinistische oder trotzkistische, antisemitische oder zionistische. Der Nationalist habe das Ziel, „immer mehr Macht und immer mehr Prestige anzuhäufen, nicht für sich selbst, sondern für die Nation oder eine andere Einheit, der er seine Individualität geopfert hat.“ (S. 8). Heute würde man das zwar nicht mehr „Nationalismus“ nennen, sondern eher ein ideologisches System mit Tendenz zum Fanatismus oder generell einen „-ismus“ aber wir bleiben einmal bei der orwell´schen Begrifflichkeit.
Orwell nennt drei Hauptmerkmale des von ihm so benannten Nationalismus: Obsession, Instabilität und Gleichgültigkeit gegenüber der Realität. Mit Obsession ist gemeint, dass fast nie über etwas anderes als die Überlegenheit der eigenen Machteinheit geredet oder geschrieben wird. Jeder Zweifel daran wird mit Widerwillen, wenn nicht schärfer, zurückgewiesen. Mit Instabilität ist gemeint, dass innerhalb einer solchen Gruppe auch inhaltliche Wechsel vollzogen oder verschiedene Inhalte thematisiert werden können. Die von Orwell kritisch betrachteten britischen Zeitgenossen lehnten z. B. den britischen Nationalismus ab, waren aber „nationalistischer“ (= fanatischer) in Bezug auf den Kommunismus bis hin zum Stalinismus als sie es je für ihr eigenes Land hätten sein können. Sie wechselten nicht selten von einer Denkschule in eine andere, z.B. vom Stalinismus zum Trotzkismus, oder sogar vom Kommunismus zum Faschismus, was in den 1930er Jahren massenhaft geschehen sei.
Gleichgültigkeit gegenüber der Realität ist dann fast schon eine logische Folge. „Der Nationalist besitzt die bemerkenswerte Fähigkeit, jene Gräueltaten, die von der eigenen Seite begangen wurden, nicht nur nicht zu missbilligen, sondern sie zudem zu überhören.“ (S. 21) Wem fallen dazu nicht spontan aktuelle Beispiele ein?
Zitat:
Sobald Angst, Hass, Eifersucht und Machtverehrung im Spiel sind, ist der Realitätssinn außer Kraft gesetzt. Und wie ich bereits erwähnt habe, ist auch das Gefühl für Richtig und Falsch, für Gut und Böse gestört. Es gibt absolut kein Verbrechen, dass sich nicht entschuldigen lässt, wenn „unsere“ Seite es begeht. Selbst wenn man nicht leugnet, dass das Verbrechen geschehen ist, selbst wenn man weiß, dass es sich um genau das gleiche Verbrechen handelt, das man in einem anderen Fall verurteilt hat, selbst wenn man in intellektueller Hinsicht zugibt, dass es keine Rechtfertigung für dieses Verbrechen gibt – selbst dann hat man möglicherweise das Gefühl dafür verloren, dass es Unrecht ist. Es geht um Loyalität, und deshalb zählen Mitgefühl und Bedauern nicht mehr. (S. 39 f)
Orwell beschreibt verschiedene Typen von „Nationalisten“ und illustriert dazu jeweils eine einfache Wahrheit, eine Tatsache, die die jeweilige Person „nicht einmal in ihren geheimsten Gedanken akzeptieren kann“. Seine Beispiele sind zeitbezogen und deshalb heute nicht immer unmittelbar einleuchtend; aber die orwell´schen Merkmale scheinen mir allgemeiner gültig zu sein. Deshalb werden sie im Folgenden auf aktuelle Erscheinungen bezogen.
Neue Beispiele zur alten Analyse
Seit Jahren prägt die Bewegung für eine bessere Umwelt mit besonderer Obsession für den „Klimaschutz“ die politische Tagesordnung. Umweltschutz ist selbstverständlich ein sinnvolles und notwendiges Ziel. Seit Jahrzehnten ist das Gegenstand unserer Politik; eine Partei mit diesem Schwerpunkt sitzt in den Parlamenten, trug und trägt verschiedentlich Regierungsverantwortung, viele politische Maßnahmen sind seit Jahrzehnten auch von anderen Demokraten und von der Gesellschaft in diese Richtung umgesetzt worden. Trotzdem trat dann eine junge Aktivistin auf, wurde von den Medien international als Ikone vermarktet und mit Followern gesegnet und forderte Panik wegen des bevorstehenden Weltuntergangs infolge des anthropogen verursachten Klimawandels. Ein starker Rückenwind für das, was Orwell Obsession nannte: als sei alle bisherige Umwelt- und Klimapolitik nichts gewesen, als müssten die Herrschenden wachgerüttelt werden, und zwar nicht nur dort, wo sie tatsächlich geschlafen haben. Der anthropogene Klimawandel stellt für die lautstarken Protagonisten dieser Bewegung jedes andere Thema in den Schatten, alles andere gehört bestenfalls nachgeordnet, sofern überhaupt beachtet.
Auch eine Gleichgültigkeit gegenüber der Realität ist bei dieser Bewegung zu beobachten. Denn eine absolut notwendige Basis für die Obsession der Aktivisten ist die Behauptung, früher sei das Klima mehr oder weniger stabil gewesen oder habe sich nur in einem Schneckentempo verändert, welches keine spürbaren Notstände verursacht habe, während heute der Mensch im Formel-1-Tempo alles zerstöre. Diese kaum übertriebene Darstellung beherrscht nicht nur das Denken einer „Letzten Generation“ oder anderer Aktivistengruppen, die sich in Abständen neu gründen, wieder verschwinden, unter anderem Namen wieder aufstehen, oft unterstützt von potenten Geldgebern im Rücken. Sondern es ist für viele beinahe zum Gemeinplatz, zur Selbstverständlichkeit geworden.
Warum dieses Denken realitätsfern ist, wird unter Klimawandel genauer betrachtet. Nie könnten diese Leute folgende Tatsachen für wahr halten: „Es hat oft auch zu Lebzeiten der Menschheit wärmere Perioden und gravierendere Temperatur-auf- und abstiege als heute gegeben / Klimawandel wie der heutige ist nicht die Ausnahme, sondern die Regel unseres Planeten / die Wirkung des anthropogen verursachten CO2 auf die Temperaturentwicklung ist erst unzureichend erforscht.“ Wer diese unzumutbaren Tatsachen ausspricht, wird „obsessiv“ in die politische Schmutzecke gestellt. Das Problem muss anthropogen sein: nur so kann man ja politische Forderungen stellen; dazu gehört logisch die Unterstellung, der Klimawandel ließe sich vom Menschen verhindern; kaum ein konstruktiver Gedanke wird an die defätistische These verschwendet, dass wir uns vielleicht auf eine globale Erwärmung einstellen sollten? NEIN, wir müssen sie verhindern! lautet die Parole.
Auch das dritte orwell´sche Merkmal, die Instabilität, ist zu beobachten. Es ist oft derselbe Personenkreis, der mit ähnlicher Obsession auch für verwandte Themen auftritt, als deren gemeinsames Merkmal man das Grenzüberschreitende bezeichnen kann: z. B. die Missachtung nationaler Souveränität beim Thema Einwanderung. Flüchtlinge, Migranten aus Asien und Afrika sollten vor wenigen Jahren möglichst unbegrenzt aufgenommen werden, da es ja schließlich Menschenrechte gäbe. (Dass dieser Zuzug gebremst wurde, haben die Träger der Willkommenskultur übrigens ausländischen Regierungen zu verdanken, die sie weiterhin als nationalistisch beschimpfen.) Diesen Protagonisten würde ein Satz wie: „Bürgerrechte sind nicht identisch mit Menschenrechten“ als nicht akzeptabler Ausdruck eines weißen Rassismus´ gelten; dies wird unter Menschenrechte, Bürgerrechte genauer betrachtet.
Nationalistischer Antinationalismus
Orwell hat bei vielen seiner intellektuellen Landsleute damals die Ablehnung der englischen Oberschicht als Quelle ihrer Obsession für den stalinistischen oder den trotzkistischen Kommunismus beobachtet. Auch heute haben „fortschrittliche“ Intellektuelle ein Problem mit ihrer Nation und pflegen einen Antinationalismus, für den globale Klimapolitik, globale Migrationspolitik, Ablehnung nationaler Souveränität, oft verbunden mit ausdrücklicher Sympathie für den raschen Aufbau eines EU-Staates, wenn nicht gleich für ein ein nebulöses Weltbürgertum, willkommene Themen sind.
Es ist eine Ironie der Begriffsgeschichte, dass die von Orwell als „Nationalismus“ bezeichnete Geisteshaltung heute als selbstgerechter („obsessiv“) und vielgestaltiger („instabil“) Antinationalismus auftritt, der auf eine recht selektive Realitätswahrnehmung angewiesen ist. Mit der Nation wird leider auch die Demokratie entsorgt (siehe Kernthema_Europäische Union).
Die Geringschätzung von Demokratie kommt bei vielen Protogonisten der genannten Themen offen zum Ausdruck, wenn man ihnen mit etwas Geduld zuhört und sie dann nach ihrem Demokratieverständnis fragt. Eine gereizte Reaktion ist noch das Wenigste, was man da erlebt. Sie erklären die Mehrheit der Mitbürger schnell für propagandistisch verführt und damit kaum ernst zu nehmen. Die schleichende Auflösung demokratischen Bewusstseins und bald auch demokratischer Institutionen wird in dieser Gedankenwelt mittransportiert. Sie hätten kein Problem damit, die Ziele, von denen sie überzeugt sind, auch gegen Mehrheiten durchzusetzen, wenn sie die Macht dazu hätten. Dieses Denken wird unter Demokratie als Erziehungsdiktatur? genauer betrachtet.
Ursache und Ausblick
Orwells auch heute aktuelle Überlegungen setzen da an, wo aus einer Gruppenidentität heraus ein „Nationalismus“ entsteht, eine aggressive, Andere abwertende und realitätsgleichgültige Haltung, die oft aus sachfremden Motiven gespeist wird, weshalb die Denkinhalte solcher „Nationalismen“ ja auch wechselnde Themen haben können. Träger solcher Haltungen mögen – so Orwell – oft schwache Persönlichkeiten, aber intellektuell gebildete Menschen sein, die sich in ihrer Herkunftskultur nicht verwurzelt fühlen und befürchten, bei mangelnder Loyalität zu ihrer neu gewählten „Nation“ ins Nichts zu fallen. Orwell fragt sich, was man dagegen tun kann und meint:
„Was die nationalistischen Liebes- und Hassgefühle angeht, von denen ich gesprochen habe, so gehören sie bei den meisten von uns zur Grundausstattung, ob wir wollen oder nicht. Ob man sie loswerden kann, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass es möglich ist, sie zu bekämpfen und dass das in erster Linie eine moralische Anstrengung ist. … Wer … (es folgen historische Beispiele für ideologiegeprägte Denkweisen) …, der kann diese Gefühle nicht einfach loswerden, indem er seinen Verstand einschaltet. Aber man kann zumindest anerkennen, dass man diese Gefühle hat, und verhindern, dass sie die eigenen Denkprozesse kontaminieren.“ (S. 41)
Das ist ein ebenso bescheidener wie ehrlicher Hinweis. Die geschilderten Gefühle tragen wir alle vielleicht als Eierschalen unseres Erwachsenwerdens noch hinter unseren Ohren, vor allem, wenn wir die Kultur, in die wir hineinwachsen, vielleicht sogar mit guten Gründen kritisch sehen. Wir klammern uns dann an ein Gegenmodell, mit dem wir unsere Identität verbinden. Wenn wir uns für eine neue „Nation“ entschieden haben, hilft Faktenwissen allein wenig, um Fehler darin zu erkennen, denn wir erlauben uns, Fakten verschieden zu bewerten. Dieser Hinweis von Orwell zeigt eine kluge psychologische Einsicht. Wahrscheinlich liegt hier ein Schlüssel für das Verständnis, warum wir schwachen Menschen oft nicht den Mut finden, uns gedanklich unabhängig um sachliche Klärungen und dann um gemeinsames konstruktives Handeln mit anderen Menschen zu bemühen. Ein orwell´scher „Nationalist“ braucht ein identitätsstiftendes Gedankengebäude und kann nicht in Ruhe und mit Fragezeichen im Kopf eine Realität betrachten, die nicht auf Anhieb zum Gedankengebäude der eigenen „Nation“ passt.
Menschenrechte, Bürgerrechte
Nicht erst seit 2015, aber seitdem vor allem, werden Menschen- und Bürgerrechte von manchen politisch interessierten Menschen durcheinandergeworfen. Das geschieht mal aus mangelnder Bildung, mal aus guten humanitären und manchmal auch aus schlechten politischen Absichten. Es geht um die Flüchtlings- und Migrationspolitik. Mit dem Argument, dass Menschenrechte ja für alle Menschen gälten, wird nicht selten suggeriert, dass damit im Sinne eines Gleichheitsgrundsatzes die Bürgerrechte des Landes auch für diejenigen mehr oder weniger anzuwenden seien, die in dieses Land fliehen. Oder einwandern. Oft wird suggeriert, dass Flüchtlinge und Migranten grundsätzlich Anspruch auf Asylrecht haben. https://www.gruene.de/themen/fluechtlinge
Das Asylrecht wird gerne als allgemeines Flüchtlingsrecht auf ein Leben in einem anderen Land missverstanden, obwohl es im Grundgesetz (Art. 16) heißt: „Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.“ Politisch Verfolgte. Nicht mehr und nicht weniger.
https://www.bmz.de/de/themen/rechte-fluechtlinge-migranten
Soweit bei diesem Thema das Mitgefühl und die Hilfsbereitschaft für Flüchtlinge im Vordergrund steht, sind die Motive menschlich sehr nachvollziehbar und aller Ehren wert. Wenn daraus nicht nur Worte, sondern Taten in persönlicher Initiative folgen, ist es umso bewundernswerter. Jeder Mensch ist aufgefordert, sich gegenüber den Mitmenschen in seiner Reichweite mitfühlend und helfend zu verhalten. Wenn das als allgemeine Handlungsmaxime beherzigt werden würde, gäbe es wohl kaum noch Elend auf der Welt.

Trotzdem muss man unterscheiden, was menschliches Handeln unter ethischen Gesichtspunkten und was staatliche Verpflichtung, staatliche Aufgabe oder sozusagen einklagbares Recht ist. Rasch werden mit dem „Menschenrecht“ auf Aufenthaltsduldung, Familiennachzug etc. Fakten geschaffen, die ein Gemeinwesen finanziell und kulturell deutlich verändern können. Dabei geht es nicht mehr um unmittelbare menschliche Hilfe, sondern um den Anspruch auf automatisch zu gewährende politische Rechte. https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/2017/08/PRO_ASYL_Broschuere_FluechtlingsuMenschenrechteinGefahr_Sept17.pdf
Protagonisten dieser Botschaft sind politische Kreise, die sich selbst als tendenziell antinationalistisch verstehen und auch unabhängig davon dazu neigen, ein Problem mit nationalen Identitäten, Staatsgrenzen etc. zu haben. Deshalb muss man sich einmal in Erinnerung rufen:
Die im Grundgesetz formulierten Grundrechte sind zum größeren Teil keine allgemeinen Menschenrechte, die jeder Bürger dieser Welt überall geltend machen darf, sondern formulieren überwiegend und ausdrücklich Rechte, die den deutschen Staatsbürgern zustehen. Was bedeutet es, dass gemäß Grundgesetz (Art. 3 (3)) niemand aufgrund seiner Herkunft, Religion etc. benachteiligt oder bevorzugt werden darf? Darf ein Flüchtling aus Mali oder aus der Ukraine damit also dieselben Leistungen beanspruchen wie ein Deutscher, der nach 30 Jahren Arbeit seine Einkünfte verloren (und vorher Steuern und Sozialversicherungen gezahlt) hat? Nein. Denn Artikel 3 (1) regelt nur, als dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind. Vor dem Gesetz! Dass niemand aufgrund seiner Herkunft, Sprache, Religion, Geschlecht etc. benachteiligt oder bevorzugt werden darf, ist eine Erläuterung dieses Grundsatzes und bezieht sich darauf, dass kein Gesetz entsprechende Unterschiede machen darf und dass in keinem Gerichtsverfahren diese Kriterien eine Rolle bei der Urteilsfindung spielen dürfen.
So gelten natürlich auch für einen japanischen oder chilenischen Staatsbürger, der sich in Deutschland aufhält, die deutschen Gesetze; wenn er sich vor einem deutschen Gericht verantworten muss, darf auch er nicht aufgrund seiner Herkunft, Religion, Geschlecht etc. benachteiligt oder bevorzugt werden. Jeder muss sich hierzulande an die deutschen Gesetze halten, so wie er sich an die Verkehrsregeln halten muss. Auch wenn er aus Thailand kommt und nur für drei Tage zu Besuch ist, darf er nicht auf der linken statt auf der rechten Straßenseite fahren. Er darf nicht nur nicht benachteiligt, sondern (zum Beispiel aufgrund von Unkenntnis) auch nicht bevorzugt werden. Aber durch den Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz wird niemand plötzlich zum deutschen Staatsbürger, dem dieselben Rechte und Pflichten zustehen.
Damit ist natürlich noch nicht geklärt, wie die allgemeinen Menschenrechte – das sind andere als die Grundrechte unseres GG – für jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt Geltung erlangen können. Fast alle Staaten haben die UN-Menschenrechtscharta unterschrieben, erkennen ihren Inhalt also an und verpflichten sich zu ihrer Achtung. Die Realität sieht leider anders aus. Dennoch müssen Menschenrechte grundsätzlich dort durchgesetzt werden, wo sie missachtet werden – oder sie bleiben verletzt und nicht durchgesetzt. Ein stellvertretender Ersatz in einem anderen Land ist in jedem Einzelfall als individuelle Hilfe zwar wünschenswert, sie kann aber nur als eine freiwillige und temporäre Hilfsleistung verstanden werden.
Wenn Migration nicht nur zur Gleichheit vor dem Gesetz, sondern zur Gleichheit in den Bürgerrechten führen soll, weil das Menschenrecht sei, so sind damit nicht nur die Menschenrechte dort nicht durchgesetzt, wo sie verletzt wurden, sondern es werden die Staatsbürgerrechte der Menschen im Aufnahmeland entwertet. Man könnte diese Folge schon eher als Verletzung von Menschenrechte bezeichnen, siehe z.B. Art. 22 der UNO-Charta:
„Jeder hat als Mitglied der Gesellschaft das Recht auf soziale Sicherheit und Anspruch darauf, durch innerstaatliche Maßnahmen und internationale Zusammenarbeit sowie unter Berücksichtigung der Organisation und der Mittel jedes Staates in den Genuss der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen, die für seine Würde und die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlich sind.“
Hier darf man die Formulierungen „als Mitglied der Gesellschaft“ und „innerstaatliche Maßnahmen und internationale Zusammenarbeit“ nicht übersehen. Das verweist zum einen auf die Gesellschaft innerhalb eines Staates und zum anderen auch auf internationale Hilfen. Die Menschenrechte sind innerstaatlich zu realisieren und ggf. sind dazu auch internationale Hilfen erforderlich. Aber durch internationale Hilfen wird weder die nationale Verantwortung eingeschränkt noch wird eine supranationale Ebene geschaffen, die die Aktivitäten zwischen weiterhin souveränen Nationen in Frage stellen würde. Die Bürgerrechte gelten in jedem Land weiter für die Bürger eines jeden Landes, und nur für sie, wie immer sie auch formuliert sein mögen. Die soziale Sicherheit eines jeden Menschen hängt gemäß Artikel 22 der UNO-Charta von den Mitteln und der Organisation des Staates ab, in dem er lebt. Die Menschenrechte, und damit die Würde und freie Entfaltung der Persönlichkeit, werden hier definiert als abhängig von den Möglichkeiten des jeweiligen Staates – ggf. unterstützt von internationaler Zusammenarbeit, worauf aber kein Rechtsanspruch besteht, weil diese von zwischenstaatlichen Vereinbarungen, also von freien Entscheidungen der Staaten abhängt. Das mag einem gefallen oder nicht, aber alles andere wäre ein Verstoß gegen das Bürgerrecht anderer Menschen, in der Gesellschaft, der sie „innerstaatlich“ angehören, ihre sozialen und kulturellen Rechte, also die spezifischen Bürgerrechte, zu wahren.
Mit einem Wort: die Menschenrechte sind in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht durch die UNO-Charta nicht im Detail positiv ausformuliert, sondern in diesen Aspekten in die Abhängigkeit der Möglichkeiten der verschiedenen Nationen gestellt. Alles andere wäre auch Unsinn. Allerdings haben die Menschen in jeder Nation ein Recht darauf, dass ihr Staat sein bestes dafür tut. Und dass er sich bei der Formulierung seiner Gesetze an einer allgemeinen Gerechtigkeit, am Naturrecht (siehe Bibliothek) orientiert. Für dieses Bemühen ist nahezu überall auf der Welt noch „Luft nach oben“.
Nebenbei bemerkt: Viele von denen, die aus den allgemeinen Menschenrechten eine Art Weltbürgertum ohne Rücksicht auf national begrenzte Rechte ableiten wollen, sind oft nicht konsequent, bzw. zeigen bei genauerem Hinsehen, dass es ihnen nicht primär oder manchmal überhaupt nicht um ethische Motive geht. Denn bald wird in solchen Debatten unterschieden, welche der Flüchtlinge oder Migranten sich wohl eignen, um die hierzulande gerade fehlenden Arbeitskräfte zu substituieren. Qualifizierte IT-Kräfte aus Indien zum Beispiel oder preiswerte Pflegekräfte aus Polen oder Indonesien. Das „Weltbürgertum“ reduziert sich dabei auf eine Art internationale Arbeitsmarktpolitik nach den Regeln des Stärkeren. Und es interessiert kaum noch, dass hierzulande gern gesehene Arbeitskräfte anderswo fehlen könnten. Ethische Kriterien mutieren an dieser Stelle leicht zum Zynismus.
Man muss immer genau hinschauen, wovon eigentlich die Rede ist, gerade wenn es um Menschenrechte geht. Damit werden in zunehmendem Maß übrigens auch Kriege „begründet“ – ein Widerspruch par excellence.
Klimawandel
Kaum ein Thema hat die öffentliche Debatte der letzten Jahrzehnte in Deutschland, in geringerem Maß auch anderswo, so kontinuierlich und anschwellend geprägt wie der Klimawandel. Und zwar der anthropogene. Denn nur was menschengemacht ist, kann ja auch Gegenstand von Politik werden. Unter „Kernthemen“ habe ich unter dem Stichwort „Kampagnenpolitik“ angesprochen, dass die Klima-Kampagne unsere Demokratie zunehmend und „nachhaltig“ prägt. Deshalb soll das Thema fachlich nun etwas genauer betrachtet werden.
Vorab zwei Beobachtungen:
Die in der Klimakampagne aktiven Bürger unterscheiden nicht gerne, ob jemand den Klimawandel generell oder den anthropogenen Anteil daran in Zweifel zieht. Wer am entscheidenden Einfluss des Menschen an einer globalen Erwärmung zweifelt, wird kurzerhand zum Klimawandelleugner erklärt und ins Abseits gestellt.
Die derzeitige Erwärmung wird oft als einmalig und mit dieser Geschwindigkeit in den letzten Jahrhunderttausenden nie dagewesen bezeichnet, was allein ja schon den Einfluss des Menschen beweise. Die „vorindustrielle“ Klimageschichte habe demgegenüber ein nahezu stabiles oder nur extrem langsam wechselndes Klima gehabt. Man muss wohl diesen weit verbreiteten Irrtum als das wirkliche „Klimawandelleugnen“ bezeichnen, wie im Folgenden gezeigt wird.
Temperaturentwicklungen ohne CO2-Anstieg
Die folgende Grafik zeigt die letzte halbe Million Jahre der globalen Temperaturen, soweit sie sich aus Baumringen, Eisbohrkernen und anderen Quellen rekonstruieren lässt. Hier werden Abweichungen von einer derzeitigen Mitteltemperatur (Nulllinie) gezeigt.

Es gab vier längere Eiszeiten und dazwischen kürzere Warmzeiten, zum Teil wärmer als heute. Dabei gab es über die Jahrtausende wesentlich mehr Sprünge auf und ab als in dieser groben Übersicht dargestellt werden können. Der Unterschied zwischen Warm- und Kaltzeit beträgt ca. 12 Grad, aber auch innerhalb dieser Zeiten ging es ständig um mehrere Grad hin und her. Wer von einer Klimastabilität vor Ankunft des Menschen (oder „vorindustriell“) spricht, hat schlicht keine Ahnung.
Betrachten wir nun die letzten 50.000 Jahre, also den rechten Ausschnitt der Grafik oben, genauer aufgelöst:
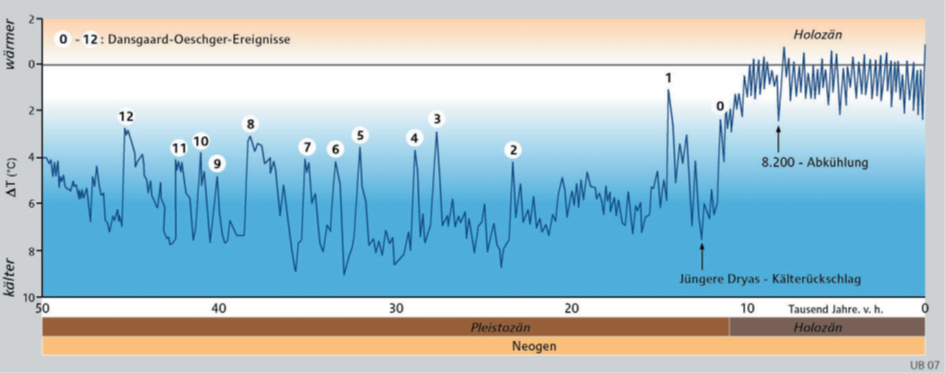
Hier werden die Sprünge innerhalb der letzten Eiszeit deutlicher. Vier Grad hoch und runter in wenigen hundert Jahren und kleinere Sprünge dazwischen gab es immer. Am Ende der letzten Eiszeit geht es in ca. 2.000 Jahren um 8 Grad hoch, wobei auch hier eine genauere Auflösung der Skala Sprünge um bis zu 10 Grad hin und her innerhalb von zweihundert Jahren zeigen würde, wie die Fachliteratur (Bibliothek) berichtet. Die letzten 8.000 Jahre sind relativ stabil, was bei genauerem Hinsehen aber heißt: ca. 30 mal ging es um 2 Grad rauf und dann wieder runter. Sprünge von 1 – 2 Grad innerhalb von 100 Jahren sind der Normalfall. Die 1,3 Grad Erwärmung in den letzten 140 Jahren ist also alles andere als auffällig, vor allem wenn man bedenkt, dass um 1880 ein ziemlich seltener Temperaturtiefpunkt zu verzeichnen war, mitbestimmt durch den Ausbruch des Krakatau.
Uns wird aber immer suggeriert, das Temperaturniveau um 1880 sei die „vorindustrielle“ Temperatur gewesen, als handele es sich dabei um etwas Stabiles oder Repräsentatives für Jahrtausende zuvor. Aber man darf doch fragen: Wenn das Pariser Abkommen eine Temperaturbegrenzung auf das „vorindustrielle“ Niveau fordert – welche Zeit ist da genau gemeint? Muss das unbedingt die Zeit von Kaiser Wilhelm I. sein? Wenn wir die sicher noch vorindustriellere Zeit der Kaiser Otto, Heinrich bis Friedrich Barbarossa oder der ersten römischen Kaiser oder der Gletscherleiche „Ötzi“ nähmen, hätten wir das Pariser Klimaziel schon erreicht oder müssten uns um eine Abkühlung bemühen.
Wir können für die Zeit seit „Erfindung“ der Landwirtschaft auch noch eine andere Grafik anschauen:

Hier werden die Abweichungen von einer 15-Grad-Mitteltemperatur während der letzten 10.000 Jahre in der nördlichen Hemisphäre in grober Zusammenfassung gezeigt. In den vorchristlichen Jahrtausenden war es lange Zeit wärmer als heute; hier wurde die Landwirtschaft erfunden und kultiviert, die ersten Hochkulturen entstanden; und auch die Warmzeiten vor 2.000 und vor 1.000 Jahren waren kulturelle Blütezeiten. Dieses Bild illustriert ebenso wie die vorigen, dass Temperaturänderungen wie sie heute stattfinden der Normalfall auf unserem Planeten sind. Eine sehr anschauliche Darstellung, was diese Wechsel in den letzten 4.000 Jahren für die kulturellen Achterbahnfahrten in Eurasien und Nordafrika bedeutet haben, gibt Kenneth J. Hsü https://dewiki.de/Lexikon/Kenneth_Jinghwa_Hs%C3%BC __ zum Beispiel in einem Artikel der Neuen Zürcher Zeitung vom 02.06.1999, leider nicht verlinkbar. Oder Franz Mauelshagens „Geschichte des Klimas“ (Bibliothek), in der sehr differenzierte Zusammenhänge zwischen Kultur- und Zivilisationsgeschichte und Klimaentwicklungen dargestellt werden, leider verbunden mit nicht näher begründeten oder kritisch hinterfragten Warnungen im Sinne des IPPC-Narrativs, siehe dazu weiter unten.
Treibhausgase – anthropogen und natürlich
Als Treibhausgase gelten die Gasanteile in der Atmosphäre, die die Eigenschaft haben, Strahlungsanteile zur Erde zurück zu reflektieren und so zur Erwärmung der Atmosphäre beizutragen. Diese Theorie ist immer noch Gegenstand von Fachdiskussionen, aber insgesamt ist es wohl unstrittig, dass es diesen Effekt gibt. Dabei wird auch diskutiert, in welchem Maß die erwärmende Wirkung von Kohlenstoffdioxyd (CO2) mit dessen zunehmender Konzentration in der Atmosphäre relativ nachlässt, sodass die Zunahme des CO2 nicht linear zur Zunahme der Temperatur führen könne. Diesen Punkt kann ich nur nennen, aber fachlich nicht beurteilen.
Ich möchte auf die Quantitäten eingehen, über die man hier spricht, bzw. meistens eben nicht spricht. Die Luft besteht zu ca. 78 % aus Stickstoff, zu ca. 21 % aus Sauerstoff, zu ca. 0,93 % aus Argon und zu den restlichen ca. 0,07 % aus den Gasen, denen man eine Treibhauswirkung zuspricht. Man ist sich weitgehend einig, dass die mittlere Temperatur auf der Erde nicht bei + 15 Grad C (heutiges Niveau!), sondern bei – 18 Grad C liegen würde, wenn es diese 0,07 % Treibhausgase in der Atmosphäre nicht gäbe. Quantitativ 90 % dieser Treibhausgase sind Wasserdampf, H2O, der aber eine etwas geringere Treibhauswirkung als das CO2 hat. Ein sehr kleiner Anteil von viel selteneren Gasen (Methan, Lachgas, Fluorgase) hat eine wesentlich größere Treibhauswirkung als CO2. Man kann alle Treibhausgase in „CO2-Äquivalente“ umrechnen. Setzt man nun die 0,07 % der treibhauswirksamen Luftmoleküle als 100 % in CO2-Äquivalente um, dann beträgt – gemäß Angaben in der Fachliteratur – der Anteil des Wasserdampfes an der Treibhauswirkung ca. 67 %, der des CO2 ca. 26 % und der der noch selteneren Treibhausgase ca. 7 %. Nächste Frage: Was davon ist anthropogen, menschengemacht?
Der Wasserdampf ist praktisch nicht menschengemacht. Sein Anteil ist übrigens schwer genau zu ermitteln und zeitlich und geographisch schwankend. Aber für grob zwei Drittel der CO2-äquivalenten Treibhausgase ist der Mensch schon mal kein Verursacher. Das CO2 war „vorindustriell“ nach verschiedenen Quellen zu ca. 2 – 4 % anthropogen, Tendenz steigend; heute mögen damit max. 35 % des CO2 anthropogen sein, wenn der gesamte Anstieg von 280 ppm vorindustriell auf 420 ppm heute dem Menschen zugerechnet wird. Das ist eine „worst-case“-Annahme. Die restlichen Gase gelten zu max. 30 % als anthropogen. Diese Angaben sind sicher nicht genau, da sie auch Schwankungen unterliegen, sie stimmen aber ungefähr in der Größenordnung. Damit beträgt der anthropogene Anteil an allen in der Atmosphäre vorhandenen Treibhausgasen in CO2-Äquivalenten 0,67 x 0 + 0,26 x 0,35 + 0,07 x 0,30 = 11 %; setzt man diese 11 % gleich 100, dann gehen ca. 2 davon, also ein Fünfzigstel, auf das Konto Deutschlands. Fast 90 % aller atmosphärischen Treibhausgase in CO2-Äquivalenten sind aber nicht menschengemacht. Wenn man genauere Angaben zur Menge des Wasserdampfes in der Atmosphäre finden will, stellt man übrigens fest, dass in der Literatur vor allem auf die Schwierigkeit einer Antwort hingewiesen wird: die Menge sei im Detail schwer zu ermitteln, weil sie erheblichen Schwankungen unterliege – sowohl zeitlich als auch geografisch. Bekanntlich nehmen die riesigen Ozeane CO2 auf, wenn sie kühler sind und geben sie wieder ab, wenn sie wärmer werden. Man könnte die Frage stellen, ob die Schwankungsbreite des Wasserdampfes vielleicht sogar eine Größenordnung erreicht wie der überschaubare anthropogene CO2-Anteil an allen Treibhausgasen, sodass der anthropogene Einfluss weiter relativiert wird. Aktuell (2023) erleben wir zum Beispiel eine Erwärmung dadurch, dass in Tonga (Pazifik) ein Unterwasservulkan ausgebrochen ist, der erhebliche Mengen Wasserdampf freisetzt, was vorübergehend zu einem signifikanten Anstieg der globalen Temperatur führen wird. Aber eben nicht menschengemacht.
Kluge Menschen haben übrigens ausgerechnet, dass ca. 10 % des anthropogenen CO2-Anteils in der Luft allein von der Atmung der heute 8 Mrd. Menschen verursacht werden. Denn beim Atmen wird bekanntlich Sauerstoff in Kohlenstoffdioxyd umgewandelt. Und auch die wachsende Zahl von Tieren, die der Mensch zu seiner Ernährung braucht (dahingestellt, ob das in der heutigen Quantität nötig ist), atmen und furzen, sodass der unveränderliche (Atmungs-)Anteil des anthropogenen CO2 von 10 auf 15 % steigen mag und der maximal veränderliche Anteil an allen Treibhausgasen weiter sinkt – es sei denn, man will die Menschheit dezimieren, siehe dazu den Abschnitt zum IPCC unten.
Was sagt uns das alles? Wenn die gesamte Menschheit aufhören würde, Treibhausgase zu produzieren, was ja völlig utopisch ist, dann könnte der Treibhausgasanteil in der Atmosphäre von heute 100 % auf bestenfalls 92 % reduziert werden. Natürlich ist auch das nicht realistisch, wenn man an Länder wie China, Indien, USA, Brasilien und vor allem an das Militär und seine Aktivitäten weltweit oder an die IT-Branche mit explodierendem Stromverbrauch denkt. Ist das eigentlich allen klar, die das CO2-Thema mit apokalyptischen Prognosen in die Politik tragen? Wir reden über wenige Prozentpunkte Treibhausgasreduktion, wenn wir schier übermenschliche Anstrengungen weltweit unternehmen. Es mag sein, dass der anthropogene Anteil zu einer gewissen Erwärmung geführt hat, die es ohne diesen Anteil nicht gegeben hätte. Sicher ist aber, dass die aktuelle Erwärmung, die ja keineswegs parallel zum CO2-Anstieg verläuft, mit Blick auf die Jahrtausende unauffällig, geradezu normal ist. Damit will ich nicht für einen sorglosen Umgang mit unseren Emissionen plädieren; ja, ist es sinnvoll, Treibhausgase zu reduzieren. Aber man sollte sich die Spielräume vor Augen führen, die uns Menschen zur Verfügung stehen. Und die Folgen einer einseitigen Fokussierung. Dann wird deutlich, dass wir uns noch andere Gedanken machen müssen, siehe dazu „Kampagnenpolitik“ bei den Kernthemen.
Die Sonne scheint … auch eine Wirkung zu haben
Das Thema globale Erwärmung wäre unvollständig, wenn man nicht darauf hinweist, dass die Treibhausgase, seien sie nun anthropogen oder natürlich, sicher nicht einzige, vielleicht nicht einmal die wichtigste Einflussgröße auf regionale und globale Temperaturentwicklungen sind. Immerhin müssten die „Klimaschützer“ ja einmal erklären, warum es „vorindustriell“ ebenfalls ständig heftige und oft heftigere globale Temperaturschwankungen gegeben hat als heute – eine Tatsache, die im gängigen Narrativ konsequent bestritten wird, obwohl sie offensichtlich ist.
Zum Beispiel weisen andere Forscher für die Temperaturentwicklung auf den Einfluss der Sonne hin, deren Strahlung zur Erde keineswegs eine konstante Größe darstellt. Es gibt nicht nur den weithin bekannten Sonnenfleckenzyklus von ca. 11 Jahren, der zu mehr oder weniger regelmäßigen Wetterschwankungen führt. Es gibt auch größere Zyklen, die in Jahrhunderten und Jahrtausenden zu messen sind.
Grund dafür sind langfristige „regelmäßige Unregelmäßigkeiten“ des Erdumlaufs um die Sonne wie zum Beispiel die Milankovitch-Zyklen und andere langfristige astronomische Exzentritäten. Sie erklären wahrscheinlich die Eiszeiten der letzten Jahrmillionen. Interessant ist noch einmal ein Blick auf die letzten 400.000 Jahre, jetzt im Zusammenhang mit den Kurven von langfristigen Schwankungen von Sonnenaktivität (weiß), Temperaturverläufen (rot) und CO2-Gehalt in der Luft (gelb).
Eine Übereinstimmung von Temperatur- und längerfristigen Sonnenzyklen ist eher grob, aber doch erkennbar. Wer aber heute mit ernsthaften Argumenten auf die Sonne als einer Ursache für Temperaturschwankungen hinweist, sieht sich in der wissenschaftlichen Welt kaum noch ernst genommen. Wir befinden uns jedenfalls seit ca. 20.000 Jahren in einem langfristigen Zyklus ansteigender Sonnenwirkung, der wohl noch Jahrtausende andauern kann und dann lange vor seinem Ende einen Temperaturabfall erwarten lässt. Das ist zumindest der Verlauf in der letzten Jahrhunderttausende.

Inhaltsverzeichnis
- Direktere Demokratie
- Die Abstimmungen
- Die Gemeinde
- Die Parteien
- Wahlrechtsreform 2023
- Reformvorschlag zur Reform
- parteilose Volksvertretung
- Bürgerräte
- Erfolgsmodell Schweiz
- Vereinigte Staaten von Europa
- Demokratie als Erziehungsdiktatur?
- Freiheit zum technischen Fortschritt
- Finanzierung staatlicher Aufgaben
- Freund und fremd
- Nationalismus
- Menschenrechte, Bürgerrechte
- Klimawandel
Besser erkennbar ist in der Grafik, dass Temperaturanstieg und -abfall im großen Maßstab den CO2-Verläufen vorausging, nicht folgte. Ein Teil der Erklärung dafür ist, dass Meerwasser, ein riesiger Speicher auf unserem Globus, CO2 freisetzt, wenn es wärmer wird und wieder speichert, wenn es kühler wird. Die Temperaturanstiege sind in der Erdgeschichte eher Ursache, nicht Folge der CO2-Anstiege. Für die letzten 70 Jahre gilt: während CO2 und andere Treibhausgase seit 70 Jahren kontinuierlich angestiegen sind, verlief die Temperatur nur zeitweise ähnlich, meist aber stärker schwankend. Schwache Korrelationen sind aber kein Beweis für starke Kausalitäten, siehe dazu das folgende Kapitel.
Korrelationen

Diese Grafik zeigt den Anstieg der Treibhausgase in CO2-Äquivalenten von 1979 bis 2019, inkl. Methan, Lachgas, Fluoride, allerdings ohne den Wasserdampf!
Der Anstieg erfolgte sehr kontinuierlich und ziemlich flach von 380 auf 500 ppm. Nimmt man den Wasserdampf dazu, der ja ca. 2/3 aller CO2-äquivalentenTreibhausgase ausmacht, dann würde die Kurve noch viel flacher verlaufen, von ca. 1.100 auf 1.220 ppm. Der Anstieg aller Treibhausgase betrug also von 1979 bis 2019 kontinuierlich ca. 10 %. Dabei ist beim Wasserdampf eine mengenmäßige Konstanz unterstellt, was fraglich ist. Soweit eine Erwärmung stattgefunden hat, kann auch eine H2O-Erhöhung stattgefunden haben – infolge der Verdunstung. Dieser Teil des Anstiegs wäre dann nicht anthropogen. Wenn man nun eine Temperaturkurve darunter legt, die einen etwas längeren Zeitraum umfasst…

…dann erkennt man, dass der Treibhausgasanstieg ab 1979 ganz gut mit einem Temperaturanstieg im selben Zeitraum korreliert.
Aber man muss auch fragen: Warum sind die Temperaturen in der Hoch-Zeit der ungefilterten Schwerindustrie in den Jahrzehnten vor dem 1. Weltkrieg gefallen? Antwort: die fehlenden Filter haben Feinstaub in die Atmosphäre entlassen, der zur Abkühlung beitrug. Warum sind sie während der Hochkonjunktur und weltweiten, schlecht gefilterten Motorisierung nach dem 2. Weltkrieg 30 Jahre lang eher gefallen als gestiegen? Antwort: Wohl aus demselben Grund. Die sicher sinnvolle Luftreinhaltung hat also auch eine Kehrseite. Warum haben die Temperaturen im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts stagniert? Obwohl der Anstieg der Treibhausgase doch weiterhin so präzise verlief wie ein Uhrwerk! Antwort: ??
Vielleicht hilft diese Literaturstelle weiter: https://www.nature.com/articles/s41558-023-01919-7. Hier wird anhand einer neuen Methode (Skelettanalysen von Sklerosschwämmen) dargestellt, dass die „industrielle“ Erwärmung bereits um 1860 begonnen hat. Der Artikel nutzt diese Erkenntnis, um damit auf noch rasanter ansteigende Temperaturen zu schließen als vom IPPC prognostiziert. Tatsächlich wird damit aber nur noch deutlicher, dass die Erwärmung wohl kaum menschengemacht begann. Mitte des 19. Jahrhunderts war die Industrie quantitativ noch schwach entwickelt und sie hat nicht nur Kohle verbrannt und damit CO2 ausgestoßen, sondern vor allem ungefilterten Rauch, der eher kühlend wirkt. Ein rasanter CO2-Anstieg begann erst Mitte des 20. Jahrhunderts. Diese Studie beweist also eher das Gegenteil von dem, was die Autoren unterstellen: Die „industrielle“ Erwärmung begann in ihren ersten Jahrzehnten oder sogar 100 Jahren nicht durch anthropogene Treibhausgase. Sondern wie schon immer in den vorindustriellen Jahrtausenden und Jahrhunderttausenden durch andere Vorgänge.
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) = „Weltklimarat“
Diese Organisation ist keine wissenschaftliche, sondern ein politische Einrichtung. Sie wurde 1988 von der UNO und von Umweltverbänden gegründet. Sie wird heute von 195 Nationen und 120 weiteren Organisationen unterstützt. Sie wertet seitdem wissenschaftliche Studien aus und publiziert in gewissen Abständen Ergebnisse, bzw. vor allem: politische Empfehlungen. Das IPCC forscht nicht selbst, sondern sammelt und fasst zusammen. Dabei ist inhaltlich von Anfang an eine klare Linie erkennbar, die das Thema des anthropogenen CO2 in den Focus und andere Positionen ins Abseits stellt. Trotzdem finden sich in den nicht der breiten Öffentlichkeit vorgestellten Basisdokumenten des IPCC auch Aussagen, die den öffentlich publizierten Empfehlungen stellenweise widersprechen. Genaue Schilderungen zur inhaltlichen Positionierung inkl. personeller Besetzung des IPCC finden sich zum Beispiel in dem bereits erwähnten Buch von Nigel Calder (Bibliothek). Man darf an dieser Stelle einmal erwähnen, dass seit vielen Jahren enorme Summen an Forschungsgeldern auch aus öffentlichen Etats in den Wissenschaftsbetrieb fließen, dessen Ergebnisse dann vom ebenfalls öffentlich bezahlten („Intergovernmental“) IPCC ausgewertet, sortiert und mit politischen Empfehlungen versehen werden. Legionen von Wissenschaftlern leben von diesem Thema. Und einer bestimmten Tendenz.
Wissenschaftler hatten festgestellt, dass es in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts einen kontinuierlichen Anstieg von Kohlendioxyd-Emissionen gegeben hat; diese werden seit den 1950er Jahren auf dem Berggipfel von Hawaii gemessen. Parallel dazu, bzw. nein, eben erst seit ca. 1980, gibt es auf der Nordhalbkugel- einen Temperaturanstieg. Das führte zu der Vermutung, dass hier nicht nur eine Korrelation, sondern eine Kausalität bestehen könne. Dieser Vermutung musste nachgegangen werden, weil sie eine zumindest theoretische Möglichkeit zur Beeinflussung durch menschliches Handeln bietet. Soweit so gut. In den Basisdokumenten des bald gegründeten Weltklimarates bestand aber auch wissenschaftliche Einigkeit, dass die wärmende Wirkung der CO2-Moleküle keine konstante Eigenschaft sei, sondern mit der Menge der Moleküle in der Atmosphäre abnehme. Eine weitgehende „Sättigung“ sei bereits ab 200 ppm gegeben, danach nehme der langwellige Strahlungseffekt, also die wärmende Wirkung, rapide ab. Die wärmende Wirkung sei bei der heutigen Konzentration von 420 ppm daher kaum eine andere als bei der vorindustriellen Konzentration. Ob diese Erkenntnisse inzwischen bestätigt oder widerlegt wurden und ob oder wie sie in Simulationsrechnungen und Prognosen berücksichtigt sind, ist mir nicht bekannt. Die Klimakampagne scheint von der variablen Sättigungseigenschaft der CO2-Moleküle allerdings nichts zu wissen oder nichts wissen zu wollen.
Nachdem die Treibhauswirkung des CO2 bei höheren Konzentrationen in Frage gestellt war, wollte das IPCC zur überzeugenden Begründung der aktuellen Klimaschädlichkeit noch einen anderen Faktor suchen und fand ihn im Wasserdampf. Wenn der steigt, funktioniert – gemäß Laborversuchen und Simulationsmodellen – die Strahlungswirkung der CO2-Moleküle auch bei höherer Konzentration. Ob das der Fall ist, kann jedoch kaum seriös nachgewiesen werden, da der Wasserdampfhaushalt der Atmosphäre sehr inhomogen und wechselhaft ist; in den Tropen ist der Wasserdampfgehalt hoch, zu den Polen hin niedrig und insgesamt sehr wechselhaft. Wenn ein hoher Wasserdampfgehalt die Treibhauswirkung begünstigt, ist es übrigens etwas merkwürdig, dass der Temperaturanstieg gerade in der Arktis und kaum in den Tropen stattfindet. Doch das nur nebenbei. Wichtig ist die Tatsache, dass das IPCC offenbar stark daran interessiert ist, den Zusammenhang zwischen Erwärmung und CO2-Anstieg zu beweisen. Es ist bekannt, dass in diesem Sinne schon Daten gefälscht wurden als im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts die Erwärmung nicht so recht vorankommen wollte. Das kam zumindest in einem Fall an die Öffentlichkeit und führte zu einem etwas peinlichen Zurückrudern des IPCC. Zu einer insgesamt kritischeren Sicht auf dieses politische Gremium führte es aber nicht. Deshalb lohnt ein Blick auf die Entstehungsgeschichte. Die scheint nach dieser Quelle
https://www.politonline.ch/index.cfm?content=news&newsid=2968
bei einer Gruppe von einflussreichen Menschen begonnen zu haben, die aus einem malthusianischen Motiv heraus die Absicht hatten, die Überbevölkerung der Erde zu stoppen oder diesen Trend umzukehren. Ich zitiere daraus:
In der Folge war es die US-Anthropologin Margaret Mead, die den Schwindel einer globalen Erwärmung als Teil einer Bewegung, die danach trachtete, das Wachstum der Erdbevölkerung zu begrenzen, 1974 in Gang setzte. Wie sie erklärte, benötigten wir anstelle zahlreicher Kinder qualitativ hochwertige Kinder. In diesem Sinn rekrutierte sie Gleichgesinnte für ihr Ziel: »Säen wir genügend Angst, dass der Klimawandel vom Menschen verursacht wird, um dadurch auf industriellem Gebiet weltweit Rückschnitte zu erreichen«; auch sollte die Entwicklung in den Drittweltländern angehalten werden. Mead hatte zuvor an der UNO-Bevölkerungskonferenz in Bukarest im August 1974 teilgenommen. Dort hatte sie mit der malthusianischen Sicht, zu viele Menschen gefährdeten die Umwelt, Wissenschaftler unter Druck gesetzt. Wie sie darlegte, wurde in Bukarest bekräftigt, dass ein anhaltend unbeschränktes, weltweites Bevölkerungs-wachstum jegliche sozioökonomischen Fortschritte zunichte machen würde und die Umwelt auf fatale Weise gefährden könnte. In Bukarest hätte der Kissinger-Plan ›NSSM 200‹ die Reduktion der Weltbevölkerung einleiten sollen, was allerdings am Widerstand der Entwicklungsländer, die damals dem Motto ›statt Industrialisierung Bevölkerungskontrolle‹ noch nicht folgen wollten, scheiterte.
Bei der hier angesprochenen Margaret Mead handelt es sich um dieselbe, die ihre Karriere Jahrzehnte zuvor mit Forschungen zum Sexualleben auf den Südseeinseln gestartet hatte. Ihr merkwürdiges Verständnis von Wissenschaft hatte sie schon damals praktiziert, indem sie mit viel Phantasie „ergänzt“ hat, was an empirischen Daten fehlte. Dass weite Teile ihrer „Beobachtungen“ in der Südsee freie Erfindung waren, wurde viel später erst aufgedeckt. Weiter im Zitat:
Kurz danach begann Mead mit der Organisation ihrer eigenen Konferenz. Diese fand vom 26. bis 29. Oktober 1975 im Research Triangle Park, einer Region in North Carolina, statt und trug den Titel ›Endangered Atmosphere‹ Conference‹. … Mead erklärte u.a.: »Wir stehen vor einer Periode, in der die Gesellschaft Entscheidungen in globalem Rahmen treffen muss. Was wir von Wissenschaftlern brauchen, sind mit genügend Zurückhaltung und Glaubwürdigkeit vorgetragene Abschätzungen, die es uns erlauben, ein System künstlicher, aber effizienter Warnungen aufzubauen, Warnungen, die den Instinkten entsprechen, die Tiere vor einem Hurrikan fliehen lassen. Es geht darum, die notwendige Fähigkeit, Opfer zu bringen, zu stimulieren. Es ist daher wichtig, unsere Aufmerksamkeit auf die Betonung grosser möglicher Gefahren für die Menschheit zu konzentrieren«. Auf dieser Konferenz wurde auch die erdachte Behauptung, vom Menschen erzeugtes Kohlendioxid würde die Erde erwärmen, die Polkappen abschmelzen lassen und menschliches Leben gefährden, ausgesprochen. Meads Hauptmitstreiter auf der Konferenz waren der Klimahysteriker Stephen Schneider, der Biologe und Bevölkerungsfanatiker George Woodwell und John Holdren, bis 2008 Vorsitzender des US-Wissenschaftsverbandes ›AAAS‹, alle drei Schüler des Malthusianers Paul Ehrlich, Autor des Buches ›Die Bevölkerungsbombe‹. …
1989 erklärte Stephan Schneider in der Oktoberausgabe des Magazins ›Discover‹: »Um die öffentliche Aufmerksamkeit zu erringen, müssen wir mit einigen angsterzeugenden Szenarien aufwarten und vereinfachte dramatische Erklärungen abgeben; und jedwede Zweifel, die wir haben mögen, dürfen wir nicht laut werden lassen. Jeder von uns muss entscheiden, wie er das richtige Gleichgewicht zwischen Effektivität und Ehrlichkeit erzielt«. Schneider setzte die Massstäbe, gemäss denen der IPCC der Öffentlichkeit seine Meinungen ohne jeden Hinweis auf Unsicherheit präsentieren kann. »Es bedarf keiner Phantasie«, vermerkte hierzu der Autor Hartmut Bachmann, »Schneiders Aussage so zu interpretieren, wie sie der Formulierung entsprechend gedacht war, nämlich als Aufforderung an Mitarbeiter und Lieferanten von Daten, diese so zu ›frisieren‹, wie sie entsprechend der politischen Aufgaben des IPCC gebraucht wurden. Beachtlich ist die Tatsache, dass hier ein hoher Beamter seinen ihm zuarbeitenden Lieferanten das Angebot macht, Urkundenfälschung zu betreiben, um ein Ziel zu erreichen«.
George Woodwell, Mitglied der ›National Academy of Sciences‹ und Fellow der ›Academy of Arts and Sciences‹ ist ein Klimaerwärmungsfanatiker, dessen öffentliche Äusserungen zeigen, dass er die Menschen ganz allgemein verabscheut und dessen diesbezüglicher Übereifer ihn dazu verleitet, die Wahrheit zurechtzubiegen. Sowohl Veränderungen als auch Erwärmung des Klimas schreibt er dem Umstand zu, ›dass praktisch jede Ecke der Erde mit Menschen zugestopft ist‹. In einem 1996 geführten Interview vertrat er die Sicht: »Die Welt war einmal völlig leer, und sie lief im Wesentlichen als eigenständiges biophysikalisches System ab; jetzt, da wir sie mit Leuten vollgestopft haben und die Summe menschlicher Aktivitäten gross genug ist, um das globale System zu beeinträchtigen, führt dies dazu, dass sie nicht mehr richtig funktioniert«.
In diesem Interview wurde er auch gefragt, wie sein Plan einer 50 %igen Reduzierung der CO2-Emissionen umgesetzt werden soll. Dies, so Woodwell, erfordere »eine konzertierte Anstrengung auf Seiten von Wissenschaft und Forschung; die Öffentlichkeit muss genügend aufgebracht sein«. Er betonte, dass die Wissenschaft ausserdem Druck auf die Regierungen ausüben müsse, damit sie handeln. Woodwells Artikel über die Klimaerwärmung, der 1989 im ›Scientific American‹ erschien, war mit einer Zeichnung illustriert, die zeigt, wie Meerwasser bis an die Stufen des Weissen Hauses schwappt. Auch der Erfinder der ›Gaia-These‹ in den 70er Jahren, Dr. James Lovelock, sieht die Erde als ein lebendes biologisches Wesen. Seine Sorge um die globale Erwärmung veranlasste ihn am 16. Januar 2006 zu folgender sinistren Vorhersage: »Bevor dieses Jahrhundert zu Ende ist, werden Millionen von uns sterben und die wenigen Nachwuchs erzeugenden Menschen, die überleben, werden in der Arktis siedeln, wo das Klima erträglich bleibt«. Immerhin stellt die Nuklearenergie für ihn ein Mittel dar, um den Eintritt des Desasters, vor dem er warnte, hinauszuzögern.
Soweit diese Zitatauszüge zur Entstehungsgeschichte des IPCC. Interessant ist auch die Tatsache, dass diese seit den 1970er Jahren begonnene Kampagne in den 1980er Jahren rasch und konsequent von der britischen Premierministerin Thatcher aufgegriffen und vorangetrieben wurde (siehe hierzu Nigel Calder; Bibliothek), was 1988 dann zur Gründung des IPCC führte. Dabei mag weniger eine Rolle gespielt haben, dass Thatcher sich so intensiv um die Umwelt sorgte, sondern eher, dass dies auch eine Kampagne für die Nuklearenergie war, was am Ende des Zitats deutlich wird.
Genauere Analysen zu den damaligen und heutigen Motiven und vor allem den Motoren dieser Bewegung bleibt zukünftigen Forschungen vorbehalten. Hier sollte nur gezeigt werden, dass vermeintlich lobenswerte Kampagnen von einer kritischen Betrachtung über ihre Hintergründe und ihre Argumente nicht ausgenommen werden dürfen. Vor allem dann nicht, wenn beim Start der Kampagne, als die heutigen „Erkenntnisse“ definitiv noch gar nicht vorlagen (damals fielen die globalen Temperaturen während die CO2-Emmissionen stiegen!), aber trotzdem Dramatisierung in Sachen Klima als politisches Mittel ausdrücklich angeregt wurde – und Jahrzehnte später die Anführerin eines medial massiv unterstützten Kinderkreuzzuges vor dem Plenum der UNO (der Mutterorganisation des IPCC!) ausdrücklich Panik in Sachen Klima fordert. Die Rechnung ist aufgegangen, darf man da wohl sagen; und die Radikaleren unter den Klimaschützern sprechen das ursprüngliche Ziel einer Bevölkerungsreduktion und De-Industrialisierung bis hin zur tiefenökologischen Gaia-These heute offen aus. Aber die echte Aufgabenstellung, wie die Menschheit vor einer tatsächlichen Erwärmung geschützt werden kann, einer Erwärmung, die der Mensch wahrscheinlich nur marginal beeinflussen wird, steht bis heute kaum auf der Tagesordnung. Geht es darum denn gar nicht?
